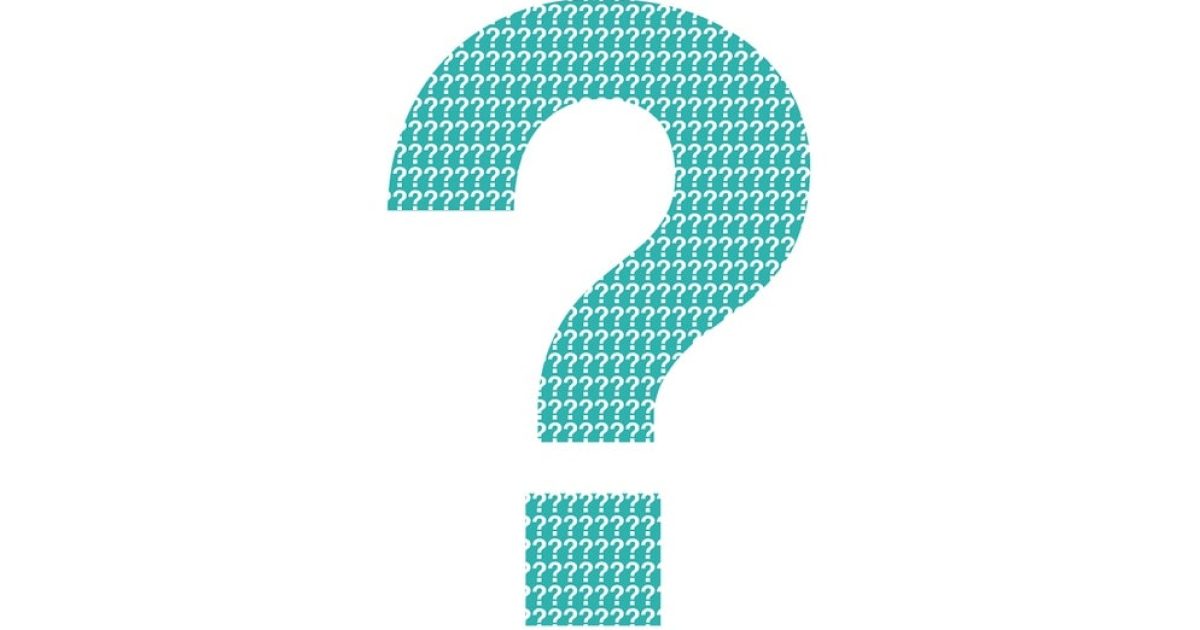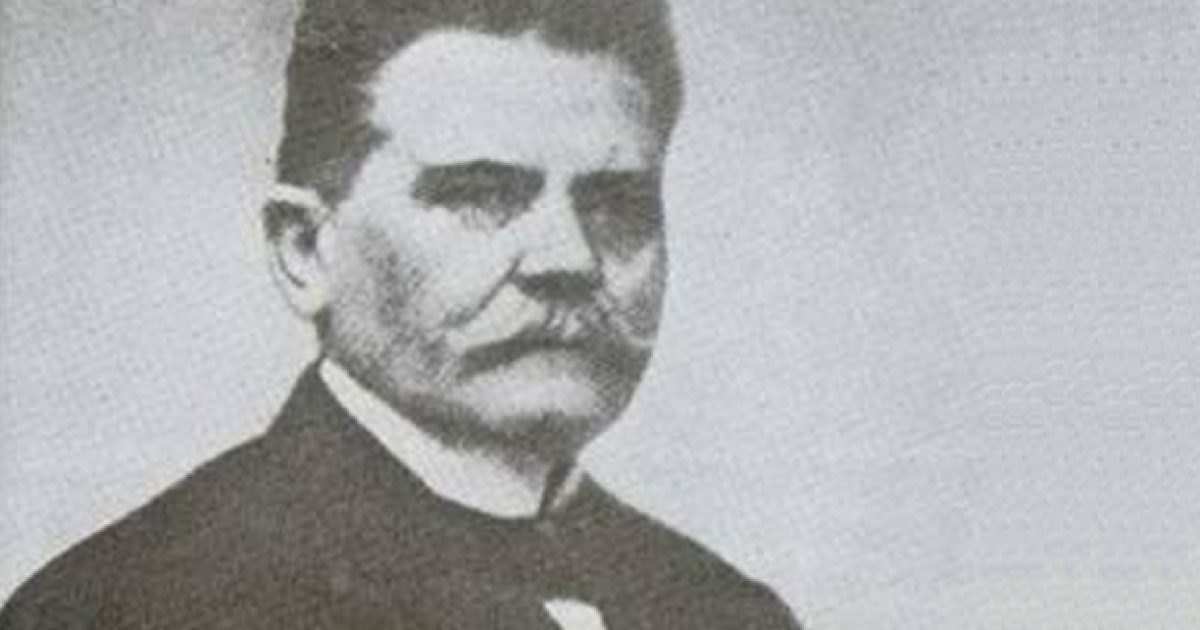Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) hat unter dem Leitwort „Steh dazu!” eine Broschüre herausgebracht über „Strategie der LdU bis 2020”.
Von Georg Krix
Versprochen wurde uns diese Strategie bereits vor zwei Jahren, dann endlich gegen Ende vorigen Jahres wurde die Fertigstellung angekündigt. Auf der Gala der Selbstverwaltungen im Januar in Fünfkirchen hat LdU-Vorsitzender Heinek das baldige Erscheinen in Aussicht gestellt. Im Mai war es dann endlich soweit. Und ab 1.
Von Dr. Wenzel Bohner
Ein interessanter Artikel. Interessant schon deshalb, weil ich ihn zweimal lesen durfte; – einmal im Sonntagsblatt und beinah zugleicher Zeit auch in der Neue Zeitung, doch hier mit einer anderen Überschrift. Da heißt es: Das Haus des Ungarndeutschtums.Legt man die zwei Überschriften zusammen, so würde das Ergebnis lauten: Das baufällige Haus des Ungarndeutschtums. Klingt gut!
Interessant aber auch deshalb, weil der Artikel aus der Feder eines
von Patrik Schwarcz-Kiefer
Das Ungarndeutschtum wurde im XX. Jahrhundert genau wegen seiner oft vorteilhaften Eigenschaft, dass es sowohl dem Ungarntum als auch dem Deutschtum gehört, vielmals von Schicksalsschlägen betroffen. Die zunehmende Assimilation, die zerfallenen Familien nach dem I. Weltkrieg, die Madjarisierungsversuche, die Verluste des II. Weltkriegs, die kollektive Schuld, die Vertreibungen und die Unterdrückung zur Zeit des Sozialismus bedeuteten tiefe Einschnitte für unsere Volksgruppe. Wenn wir das Ungarndeutschtum uns als
Von Richard Guth
Nach fünf Jahren Dienst verlässt der deutsche Pfarrer Gregor Stratmann Budapest. Aber nicht nur die Deutschsprachige Elisabethgemeinde Budapest nimmt Abschied vom westfälischen Geistlichen, sondern auch die Ungarndeutschen, deren wahrer Freund und Fürsprecher Gregor Stratmann in den Jahren geworden ist. Das Sonntagsblatt, zu dessen treuen Lesern der Geistliche von der ersten Minute in Ungarn an gehört, führte ein Interview
mit dem 60-jährigen Deutschen.
SB: Pfarrer Stratmann, von Anfang
von Thomas Konhäuser
Der Erhalt und die Pflege der deutschen Sprache und die Förderung des Sprachgebrauchs ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Hilfen- und Förderpolitik der Bundesregierung für die Angehörigen der Deutschen Minderheiten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Hierzu bedarf es auch einer wissenschaftlichen Fundierung.
Zur Erörterung der hiermit zusammenhängenden Fragen traf sich der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, mit dem Leiter des Forschungszentrums
Neben den im Mittelalter entstandenen sächsischen (mosel- und rheinfränkischen) Gemeinden, bzw. in der Nachbarschaft der während des Schwabenzugs vor Ort neue Heimat gefundenen Banater Schwaben war auch eine urspünglich österreichische Bevölkerung in Siebenbürgen bekannt, namentlich die Landler.
Die ersten protestantischen Siedler waren wegen ihrer Religion gezwungen, Salzkammergut und Steiermark zu verlassen, demzufolge nahmen sie die Richtung nach Siebenbürgen, wo sie sich in mehreren Siedlungen, wie in Großpold, Großau, und nicht
Ein Artikel aus 1951 – der im Büchlein „Aus donauschwäbischem Erbe“ von Hans Diplich (1952) gefunden wurde – berichtet:
Für eine kleinere Gruppe von Bukowinadeutschen findet die schon zehn Jahre währende Irrfahrt ihren Abschluss. Als die ehemaligen Kolonisten aus der Bukowina (etwa 80 000 Seelen) aus Bessarabien (80 000) und der Dobrudscha (12 000) aufgefordert wurden, ihre Heimat zu verlassen, hatte man ihnen Haus und Hof, Arbeit und sichere Lebensstellungen
Die politische Konzeption Jakob Bleyers Vor 100 Jahren stieg Jakob Bleyer in die Politik ein
Die bedeutendste Persönlichkeit der ungarndeutschen Geschichte von 1917 bis zu seinem Tod 1933 war Jakob Bleyer. Am 25. Januar 1874 in Tscheb, in der nach 1918 jugoslawischen Batschka, als Sohn bäuerlicher Eltern geboren, war ihm die bäuerliche Lebenswirklichkeit der ungarndeutschen Bauern zutiefst vertraut. Er besuchte nach der deutschsprachigen Volksschule seines Heimatortes die Gymnasien in Neusatz