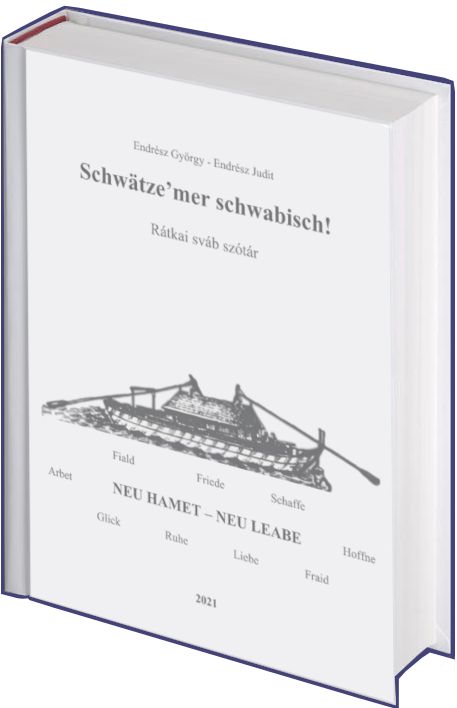Mit der Dialektwörterbuchautorin Judit Endrész aus Ratka im Gespräch
_____________________________________
SB: Frau Erdész, Sie haben heuer ein Mundartwörterbuch herausgebracht – wer war Ideengeber des Projekts bzw. woher kam die Motivation?
JE: Mein Vater, Georg Endrész, war der Ideengeber. Er ist Lehrer für Geschichte, Russisch und Deutsch. Er hatte seit Jahren schon vor, dieses Wörterbuch zu machen, ihm fehlte aber einfach die Zeit. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert und Dialekte haben mich schon immer fasziniert. Der zeitliche Aufwand und die Komplexität der Sache haben mich aber zurückgeschreckt, so dass mein Vater ganz lange gebraucht hat, bis er mich vom Projekt überzeugen konnte. Bei uns in Ratka reden nur noch die 70-80-Jährigen „Schwäbisch“ und uns hat sehr besorgt, dass, wenn sie sterben, dann auch dieser wunderbare Dialekt verschwindet, den unsere Vorfahren fast 300 Jahre lang in einer ungarischen Sprachumgebung bewahren konnten. Daher kam die Motivation. Wir wollten einfach nicht, dass er spurlos verschwindet.
SB: Was war das konkrete Ziel des Projekts, wer war an der Sammlung und Zusammenstellung beteiligt? Und welchen Anteil hatte die Deutsche Selbstverwaltung am Zustandekommen des Wörterbuchs?
JE: Da es im Fall des Ratkaer Schwäbischen um eine quasi veraltete Sprache geht (Ratka liegt ja nicht inmitten einer deutschen Sprachinsel in Ungarn (im Sinne von deutschen Sprachinseln in einem ungarischsprachigen Umfeld, Red.) und hatte mit Deutschland keinen Kontakt mehr seit der Auswanderung Mitte des 18. Jahrhunderts, so konnte sich die Sprache nicht entwickeln), haben wir nicht darauf gehofft, dass es erlernt wird, weil wir dieses Wörterbuch haben. Für die sprachwissenschaftliche Forschung könnte es aber durchaus interessant sein. Unser Ziel war einfach, dass die Sprache nicht ganz verloren geht, auch wenn sie nicht mehr gesprochen wird. Dieses Wörterbuch ist so wie ein Denkmal. Mein Vater Georg Endrész hat 90 % der Arbeit allein gemacht. Er hat die Wörter und Redewendungen fast vier Jahre lang gesammelt, hat Tonaufnahmen gemacht, dann hat er die Aufnahmen zu Hause bearbeitet. Er hat sogar Konjugations- und Deklinationstabellen erstellt. Dieses Wörterbuch ist eigentlich sein Wörterbuch, ich habe ihn nur auf dem Weg begleitet und ihm bei der Vereinheitlichung der Schriftweise geholfen. Herausgeber des Wörterbuchs ist der Verein „Schwarzwald“. Die Deutsche Selbstverwaltung war diesmal nicht involviert.
SB: Welche besonderen Erfahrungen haben Sie bei der Arbeit gemacht?
JE: Dass diese Sprache noch viel interessanter ist, als wir uns am Anfang gedacht haben! Es gab viele Wörter, mit denen wir zuerst nichts anfangen konnten. Ich meine, aus dem Kontext stellt sich zwar heraus, was sie bedeuten, wir mussten sie aber diesmal schriftlich wiedergeben und dann soll man im Idealfall wissen, wo sie herkommen. Zum Beispiel wird das Verb [khoie] sehr oft verwendet und wir konnten sehr lange nicht herausfinden, worauf es zurückzuführen ist und wie wir es schreiben sollen. Nach langer Recherche hat sich herausgestellt, dass es auf die alten Verben „geheien”, „keien” (‘werfen’, ‘fallen’, Quelle: Wörterbuch Grimm) zurückzuführen ist, die heutzutage wahrscheinlich niemand mehr kennt. Es gibt aber noch viele, viele spannende Beispiele und wir haben oft nachgeschaut, in welchen Teilen Baden-Württembergs der eine oder der andere Ausdruck heute noch verwendet wird, den unsere Leute hier auch verwenden, und so ist in uns irgendeine psychische Verbindung zu dem Herkunftsland unserer Vorfahren entstanden, auch wenn das sich etwas komisch anhört.
SB: Erzählen Sie bitte ein wenig über den Ratkaer Dialekt! Wie viele Dialektsprecher gibt es noch im Ort und welche ortsspezifischen Gründe gab es für den Verlust des Dialekts?
JE: Das Ratkaer Schwäbische weicht stark von dem heutigen Schwäbischen ab, auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt. Es ist eine stark diphthongierte Sprache mit teilweise hochalemannischen Merkmalen (dank der Nähe des Schwarzwalds zu den Herkunftsdörfern). Schwer zu sagen, wie viele Dialektsprecher es in Ratka noch gibt! Es gibt viele, die „passive“ Dialektsprecher sind: Ich meine diejenigen, die ihn verstehen, aber wenn sie im Dialekt angesprochen werden auf Ungarisch antworten. Tagtäglich schwätzen nur noch die 70-80-Jährigen schwäbisch, höchstens 150 Personen.
Ratka war lange ein geschlossenes Dorf, lange haben die Dorfbewohner untereinander Familien gegründet. Da Ratka weit weg von den deutschen Sprachinseln in Ungarn liegt, musste es sich irgendwann aus praktischen Gründen (Wirtschaft, Arbeit) doch öffnen. Heutzutage gibt es sehr viele Zugezogene, die mit Schwäbisch überhaupt nichts zu tun haben. Das ist der eine Grund für den Verlust. Dagegen kann man nichts machen, man kann ja niemanden zwingen, in Ungarn einen fremdsprachigen Dialekt zu sprechen.
Ein anderer Grund für den Verlust ist, dass dem deutschen Volk nach dem Zweiten Weltkrieg Kollektivschuld zugewiesen wurde. So war es ja nicht günstig, einen deutschen Dialekt zu sprechen.
Ein dritter Grund ist, dass wir hier, im Nordosten einfach vergessen wurden. Die Dialektforschung beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Sprache der Sprachinseln. Das finde ich sehr traurig. Aufmerksamkeit hätte Wunder bewirken können. Uns selber ist es auch spät bewusst geworden, wie großartig und rührend das ist, in Ostungarn einen deutschen Dialekt so lange und allein gelassen pflegen zu können. Die Ignoranz ist eine große Enttäuschung, denn seien wir mal aufrichtig: Sprachinseln hatten und haben es viel leichter.
SB: Was wird unternommen, dem Verlust des Dialekts/der deutschen Sprache entgegenzuwirken? Gibt es schulische oder kirchliche Angebote in Deutsch und wenn ja, wie schätzen Sie deren Wirkungsgrad ein?
JE: Deutsch wird in der Schule unterrichtet. Es gab vor ein paar Jahren sogar ein Experiment für eine zweisprachige Unterrichtsmethode, das jedoch nicht erfolgreich war. Großeltern bringen noch schwäbische Sprüche und Lieder den Enkelkindern bei. Der Verein „Schwarzwald“ organisiert auch oft Treffen für die Dorfbewohner und es gibt auch das von der Gemeinde organisierte, jährlich veranstaltete Nationalitätenfestival.
Ich finde aber, dass man nichts mehr machen kann. Einerseits ist es zu spät. Andererseits gibt es die Zuwanderung, mit der alle Dialektgruppen zu kämpfen haben.
SB: Hat dieser Verlust auch Auswirkungen auf die Identität der Bewohner? Wie viele Deutsche/Deutschstämmige leben eigentlich noch im Ort?
JE: Identität ist eine schwierige Frage. Was heißt das, zu dieser oder zu jener Volksgruppe zu gehören? Keine Volksgruppe ist besser als die andere und man ist ja dieselbe Person, auch wenn man sich als Ungar/in oder als Ungarndeutsche bekennt. Warum hat das trotzdem eine Bedeutung? Die Antwort weiß ich bis heute nicht, obwohl ich sehr viel darüber nachdenke. Wir sind so aufgewachsen, dass man uns gesagt hat, dass wir „Schwaben“ sind. Das ist für viele Deutsche natürlich unverständlich, wenn sie das hören, weil Schwaben ja schwäbisch reden. Ich persönlich formuliere das so: Wir sind Ungarn mit deutschen Vorfahren. Zum zweiten Teil der Frage: Ich würde sagen, ca. 60-70% des Dorfes.
SB: Wie sehen Sie die Zukunft Ratkas – Demografie, Sprache, Identität, Wirtschaft/Arbeit?
JE: Ratka wird nicht verschwinden. Es ist ein schönes, sauberes Dorf zu ostungarischen Verhältnissen. Für junge Familien ist es in den letzten Jahren attraktiv geworden, auch wenn es im Dorf nicht viele Arbeitsmöglichkeiten gibt. Schwäbisch verschwindet aber höchstwahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten. Es wird aber in Erinnerung behalten – ganz lange, da bin ich mir sicher. Dazu trägt unser Wörterbuch auch bei.
SB: Frau Endrész, vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Richard Guth.
_____________________________________________
Das VORWORT des Wörterbuchs
Nicht weil wir uns der Hoffnung hingaben, dass das altschwäbische Idiom unseres kleinen nordostungarischen Dorfes namens Ratka dadurch gerettet werden könnte, entschieden wir uns, ein Wörterbuch seiner Mundart zu widmen. Dadurch dass wir das dort gesprochene Schwäbisch aber schriftlich wiedergeben und gleichsam festhalten, kann es nicht ganz verloren gehen – davon sind wir überzeugt.
Überdies fanden wir etwas ungerecht, dass wir hier, im Nordosten Ungarns, in Vergessenheit gerieten. Und so wollen wir mit dem vorliegenden Wörterbuch nicht zuletzt die Aufmerksamkeit der Sprachwissenschaft auf uns lenken. Wenn man auch bei der Untersuchung der Sprache den ungarischen Einfluss, was Satzbau, Lehnwörter, Hungarismen, Aussprache usw. betrifft, nicht verleugnen kann, hat sie in sprachwissenschaftlicher wie soziologischer Hinsicht einen nicht zu unterschätzenden Wert. Sie eröffnet uns nicht nur einen Einblick in den Zustand des Schwäbischen des 18ten Jahrhunderts, sondern eigentlich auch in den des damaligen Hochdeutschen. Spannende sprachwissenschaftliche Umstände und die – dank der Nähe des alemannischsprachigen Schwarzwaldes zu den schwäbischsprachigen Herkunftsorten in den Landkreisen Tuttlingen und Sigmaringen – merklichen alemannischen Eigenheiten verleihen dieser Mundart eine ganz spezielle Färbung. Aus dem Wortschatz können wir auch darauf schließen, wie unsere Vorfahren damals den Alltag meisterten, wovon sie lebten, welche Gegenstände sie dabei gebrauchten, welche Eigenschaften sie hochschätzten, welche Gefühle sie damit ausdrückten.
Es erscheint bemerkenswert, sogar rührend, dass diese Mundart seit fast 300 Jahren in einer fremdsprachlichen Umgebung – selbst nach den katastrophalen Folgen des Zweiten Weltkriegs, die das Leben der deutschsprachigen Minderheit unter dem Zeichen kollektiver Anschuldigung prägten (im Falle von Ratka hieß das: Verschleppung nach Russland in die Zwangsarbeit) – weit weg von der ursprünglichen Heimat bewahrt wurde.
Es ist sicherlich für jedermann einfach nachzuvollziehen, warum Dialekte es heutzutage generell schwierig haben. Wir bewegen uns freier, sind nicht mehr so ortsgebunden wie früher. Dafür brauchen wir „Hochsprachen“, damit Einheimische und „Neigschmeckte“ sich leichter verständigen können. Das erschwert die Bewahrung von Mundarten natürlich enorm. Besonders schwierig ist die Lage der Dialekte, die weit weg von der ehemaligen Heimat, in Ländern gesprochen werden, deren Nationalsprache mit dem jeweiligen Dialekt gar nichts Gemeinsames haben: so wie des Schwäbischen in Ungarn. In Ungarn gibt es zwar aus mehreren Siedlungen bestehende schwäbische Sprachinseln; was aber unser Untersuchungsobjekt betrifft, ist das nicht der Fall. Ratka liegt allein im Nordosten. Es gibt in der Nähe (40-50 km weit entfernt) zwei Siedlungen, die zur selben Zeit und im Rahmen derselben privaten Besiedlungsaktion des Habsburgischen Hofes mit Schwaben aus Baden-Württemberg besiedelt wurden, nämlich Hercegkút (Trautsondorf) und Károlyfalva (Karlsdorf), dort redet aber niemand mehr die Sprache. In Ratka spricht leider auch nur noch die älteste Generation Schwäbisch. Die Generationen mittleren Alters verstehen es zwar, reden es aber nicht und die ganz Jungen kennen nur noch einige Gedichte und Sprüche. Im Laufe der dreieinhalb Jahre, in denen wir unsere Recherchen und Befragungen durchführten – zumeist in der Tagesstätte für alte Leute -, starb die Hälfte der befragten Personen! Sie waren alle über 80 und noch Mitglieder der Generation gewesen, deren Muttersprache Schwäbisch war und die erst in der Grundschule Ungarisch lernten.
Die Zukunft? – Hat es denn heute noch einen Sinn in unserer nutzorientierten Welt, diese Sprache zu erlernen, die von deutschen Muttersprachlern zwar gewissermaßen verstanden wird, aber vom heutigen Schwäbischen stark abweicht, größtenteils veraltet wirkt und mit ungarischen Lehnwörtern angereichert ist? – Die Antwort fällt uns schwer. Uns beruhigt aber einigermaßen, dass wir dieses Wörterbuch endlich in der Hand halten, auch wenn sehr bald nur noch unsere DNA unser Schwäbisches Erbe bewahren wird.
Ratka, den 07. 12. 2021 Georg Endrész, Judit Endrész