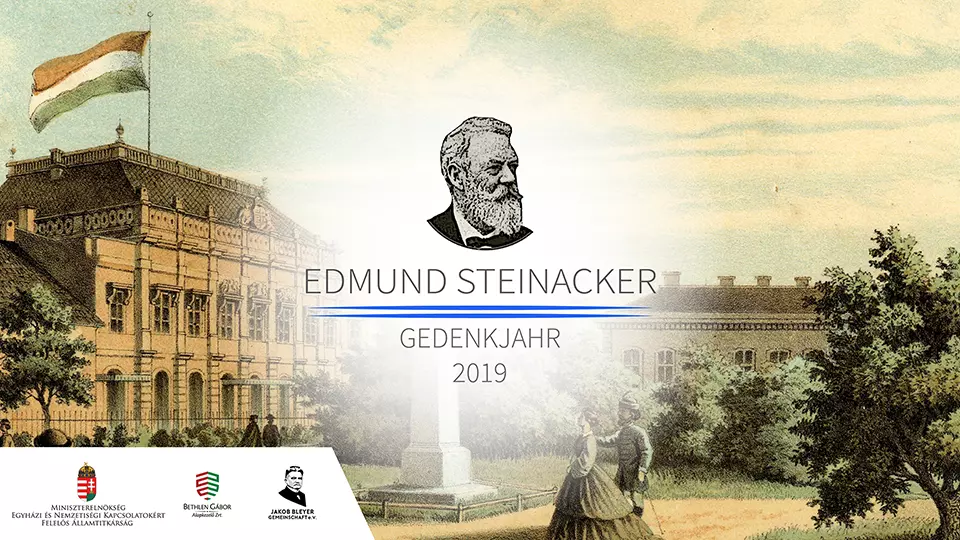Vor 180 Jahren geboren und vor 90 Jahren verstorben
Edmund Steinacker, die vorbildliche ungarndeutsche Persönlichkeit hat sein ganzes Leben zum Wohle des ungarländischen Deutschtums geopfert. Unter anderem war er der erste und größte Verfechter einer gemeinsamen deutschen Identität im Karpatenbecken, von Deutschwestungarn bis nach Siebenbürgen, von der Zips bis in die Batschka. Sein Name geriet zu Unrecht in Vergessenheit, dies will die Jakob Bleyer Gemeinschaft verändern und im Jahre 2019 seine vielfältige Tätigkeit der ungarndeutschen und der breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Während des ganzen Jahres werden neue Projekte und Programme in dem Themenbereich „Edmund Steinacker und seine Ära” organisiert, deren Höhepunkte das für den Herbst geplante Sonntagsblatt-Magazin und das nach Edmund Steinacker benannte Stipendium sein werden. Als erster Schritt hat die Jakob Bleyer Gemeinschaft eine Kranzniederlegung am Grabe Steinackers in Klosterneuburg, Niederösterreich, veranstaltet, wo Vorstandsmitglied Stefan Pleyer Steinacker im Rahmen einer würdigen Rede gedachte.

Im Weiteren finden Sie die Gedenksrede:
Geehrte Anwesende der Jakob Bleyer Gemeinschaft, liebe Landsleute,
in der ungarndeutschen Erinnerungsgeschichte,wenn wir sie überhaupt so nennen dürfen, bringt der heutige Tag etwas Neues: Das wird nicht nur das Leben unseres Vereins, sondern auch das des gesamten Ungarndeutschtums beeinflussen –ich will um Gottes willen nicht zu pathetisch werden, aber unseres Wissens nach haben sich zum ersten Male ungarländische deutsche Landsleute hier in der unterennsischen Klosterneuburg beim Grabe Edmund Steinackers versammelt, um vor Ort, in Körper und Geist einer großen und bisher leider für die breitere Öffentlichkeit vergessenen historischen Persönlichkeit Respekt zu zollen.Wir stehen bei den Gebeinen eines solchen Mannes, der genauso wert wäre, Namensgeber unserer Organisation zu sein wie der Batschkaer Jakob Bleyer.
Nicht zufällig haben wir den heutigen Tag und das jetzige Jahr für die Gedenkveranstaltung ausgewählt. Vor genau 90 Jahren, am 19. März 1929, verstarb Edmund Steinacker in der neben uns liegenden Klosterstadt Klosterneuburg. Aber bevor wir seinen Lebenslauf mit seinem Tode abschließen,lasst uns erzählen, wie der ungarländische Archetyp des Bürgerslebteund wirkte, und warum er unseren Dank verdient.
Auch sein Geburtsjahr gibt Grund für die jetzige Erinnerungsfeier: Im Jahre 1839 kam Edmund Steinacker in der ostungarischen Cívis-Stadt Debrezin zur Welt. Er stammte aus einer wahrlich europäischen Familie: Die väterliche Familie verortete seine Wurzeln im Quedlinburger Gebiet, also in Altsachsenland, in der Pfalz der ersten sächsischen Könige, wo der Vater Ottos des Großen als Stammvater der sächsischen Dynastie die Grundsteine des frühdeutschen Staates im Rahmen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation legte. Diese Symbolik erschien gewiss in der Familie Steinacker. Seine Mutter, Aurelia Westher, stammte aus der Zips, noch genauer aus Käsmark. Nicht nur die Familiengeschichte weist auf die Zugehörigkeit der Steinackers zur Schicht der Bürger: Gustav Steinacker war als evangelischer Theologe, Lehrer tätig, er übte seinen Beruf im Debreziner Mädelgymnasium aus, und in dieser Position galt er als ein angesehener Cívis unter den Debrezinern. Später kamen die konfessionellen Unterschiede hevor, infolge dessen die Familie 1842 ins Zipserland, nach Gölnitz weiterziehen musste. Aus persönlichen Gründen waren sie danach erneut gezwungen, ihr Zuhause zu verlegen, diesmal nach Triest, wo der Vater Verwandtschaft hatte.
Mittendrin in diesem kosmopolitischen Milieu wurde die Identität des jungen Edmunds geformt: Einerseits war er häufig mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Kulturen konfrontiert, was ihm neue Perspektiven eröffneten, er eignete sich einen sicheren Auftritt im Ausland, andererseits wurde in Debrezin, Gölnitz und Triest seine deutsche Bekenntnis geformt und gefestigt. In den 1850er Jahren lebten die Steinackers im schwäbischen Stuttgart, wo Edmund Ingenieurwissenschaft studierte. Neben der Universität wurdesein Studentenleben durch Kontakte zur StudentenverbindungCorps Teutonia zu Stuttgart bereichert.
Nach dem Studium leistete Steinacker, wie Goethes Wilhelm Meister, Wanderjahre in verschiedenen europäischen Ländern, Frankreich, England. Er blieb dem ungarischen Vaterlande treu, welche Liebe Steinacker von seinem Vater erbte, der ebenfalls ein großer Befürworter des Hungarus-Selbstbewusstseins war. In Ungarn und Kroatien setzte er zuerst die technischen Erfahrungen in klingende Münze um. Der Wind der Veränderung des politischen Status Quo 1867 in Ungarn erreichte auch ihn: In der Debatte zwischen den politischen Frontlinien spielte auch die Nationalitätenfrage eine markante Rolle. Steinacker erkannte diese Dürftigkeiten im noch noch im Aufbau befindlichen Staatssystem, und nahm die Probleme des Ungarndeutschtums im Spiegel des Nationalitätengesetzes 1868 unter die Lupe. Sein Sprachrohr war zuerst die Pressburger Zeitung, wo er die ersten Diagnosen in der Artikelreihe „Das Bürgertum im politischen Leben Ungarns” aufstellte, grundsätzlich unter dem Aspekt der bürgerlichen Klasse, in der auch der frisch gebackene Publizist heimisch war.
Im Jahre 1875 ging er in die Politik,um die sich für Verbesserungen im Leben des Ungarndeutschtums einzusetzen. In diesem Jahr wurde er Abgeordneter des ungarischen Landtags, er vertrat dennoch nicht das deutsche Volk in Ungarn, sondern im Komitat Szeben/Hermannstadt, nachdemdie sächsische Universitas 1876 im Rahmen der Verwaltungsreform abgeschafft wurde. Natürlich vetritt er weniger die Belange der Sebener, vielmehr die Interessen des deutschen Bürgertums. 1880 bestimmte Steinacker das politische Credo der Deutschen für die kommenden Jahrzehnte in dem von ihm gegründeten Budapester Tagblatt: „Jawohl, meine Herren! Wir wollen ein neues deutsches Blatt sein für das Volk, für diejenigen, mehr Hunderttausende, die sich als Ungarn und loyale Staatsbürger fühlen, aber gleichzeitig sind sie darauf stolz, dass sie deutsche Bürger sind, wessen Väter für dieses Land bluteten und arbeiteten.” Auch die heutige Geschichtswissenschaft beurteilt die Rolle Steinackers präzise: Er war der erste ethnopolitische ideologische Denker, der die verschiedenen deutschen Volksgruppen von den Heanzen über die Donauschwaben bis zu den Siebenbürger Sachsen in ein Lager führen wollte, um ihnen zuerst ein weit verbreitetes Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben, und danach eine politische Organisation, später möglicherweise eine konkrete Vertretung zu erkämpfen.
Diese Stimmen der deutschungarischen Rienzi, unseres ersten Volkstribuns, klangen hingegen in den Ohren der ungarischen politischen Elite feindlich: Deutschtum und seine Interessen zu betonen war den höheren Ohren zu „madjarenfeindlich” und verräterisch, obwohl Steinacker mehrmals Treue dem ungarischen Vaterlande schwor, auch in seinen in Württemberg verbrachten Jahren. Seine Siebenbürger sächsischen Landsleute waren gezwungen, sein Mandat zu widerrufen.
Wie der Nietzsche’sche Zarathustra, kam der deutschungarische Feuerbringer zu früh zu seinem Volke. Er zog sich aus der Politik zurück, ließ sich in Wien nieder, später hier, in Klosterneuburg, aber blieb nicht tatenlos, das gab seiner Tätigkeit sogar einen neuen Schwung .Schnell nahm er Beziehung zum Alldeutschen Verband auf und begann eine Organisation im Banat und in der Batschka aufzubauen, wessen Resultat die Ungarländische Deutsche Volkspartei 1906 und eine Zeitung, der Deutschungarische Volksfreund, waren. Wahrlich, von Anfang an konzentrierte sich Steinacker bei der politischen Zielsetzung nur auf das Bürgertum, da nach seiner Überzeugung diese gesellschaftliche Schicht das Nationalgefühl am besten entwickeln kann. Die Partei erlebte ein relativ schnelles Wachstum, landesweit konnte die Partei Kandidaten nominieren, jedoch konnte sie am Vorabend des ersten Weltkriegs nicht erfolgreich sein. Auch im Kreise des europäischen Gesamtauslandsdeutschtum erfüllte er die Rolle des Fackelträgers – so verließ er uns vor 90 Jahren, am 19. März 1929, der Klosterneuburger Eremit auf ewig.
Manche heben den Misserfolg im Lebenswerk Edmund Steinackers hervor. Wir müssen es zugeben, ja, er konnte viele Vorstellungen nicht verwirklichen, aber er war der erste Fackelträger, der erste Volkstribun, der den Wecker im Kopf des deutschen Bürgertums einstellte. Zu Jakob Bleyer pflegte er eine für die Zukunft mehr als konstruktive Freundschaft, er gab ihm die Stafette weiter, und die Vision Steinackers wurde, mit Veränderungen, durch Bleyer in Gießform gegossen.