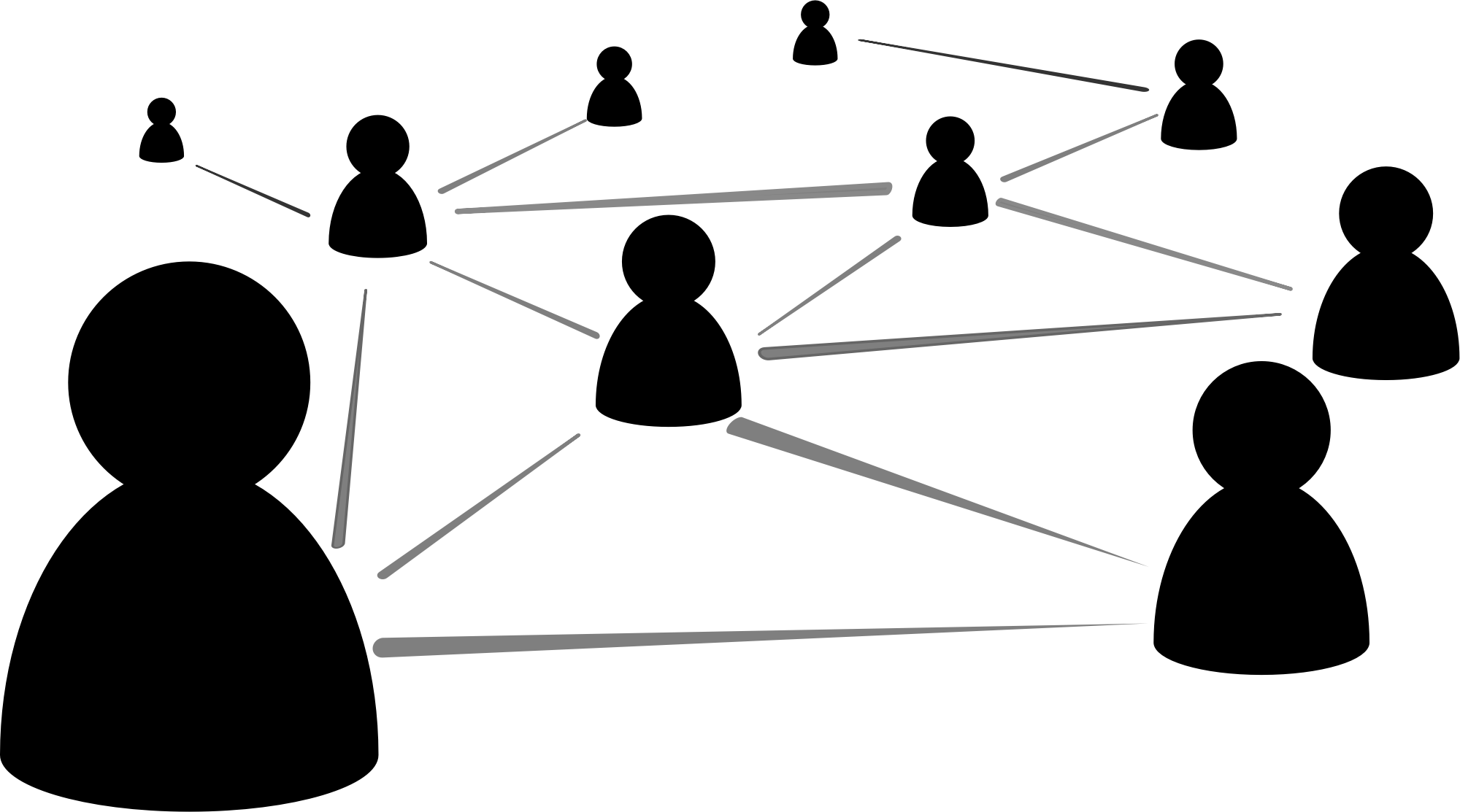Konferenz widmet sich der Netzwerkbildung im Kreise der Ungarndeutschen und nach außen im 20. Jahrhundert
______________________________________________________________________
Von Gabriel Grob und Richard Guth
Zu einer wissenschaftlichen Konferenz lud Interessierte Mitte November das Institut für Minderheitenforschung des Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrums (TK KI) des Loránd-Eötvös-Forschungsnetzwerks (ELKH) und der Stiftungslehrstuhl für Deutsche Geschichte und Kultur im Südöstlichen Mitteleuropa an der Universität Fünfkirchen. In der Konferenz ging es um Netzwerke und Beziehungen der deutschen Minderheit in Ungarn, nach innen und nach außen.
Den Vormittag widmete man dem Volksbildungsverein von Jakob Bleyer und dem Volksbund von Franz Basch – den beiden wichtigsten Organisationen des Ungarndeutschtums zwischen den zwei Weltkriegen bzw. während des Zweiten Weltkrieges. Diese waren die ersten „Netzwerke” der Volksgruppe, betonte Franz Eiler (TK KI) im ersten Vortrag. Die Vorgängerorganisationen (z. B. die von Edmund Steinacker) wurden kurz auch erwähnt.
Das Grundprinzip des Volksbildungsvereins (MNNE) war laut Eiler: „Wir sind Teil des deutschen Volkes, aber auch Teil der ungarischen Nation.” De jure war der Volksbildungsverein ein Kulturverein, de facto aber „die Partei der Deutschen”, zumindest sei er als Partei betrachtet worden, aber die Vorteile einer Partei habe er nicht gehabt.
Die deutsche Bewegung in Ungarn wurde (inoffiziell) schon zur Zeit Bleyers von Deutschland finanziert, hauptsächlich über das Sonntagsblatt! Dies ermöglichte eine enorme Unabhängigkeit, so die Forschungsergebnisse.
Zwischen der oberen Führung und den Ortsgruppen habe es keine mittlere Stufe gegeben. Die Zentrale habe per Telefon den Kontakt zu den Ortsgruppen halten oder sie im Winter 1- bis 2-mal pro Jahr besuchen können. Beim Kontakt war nach Eiler das Sonntagsblatt auch ein wichtiges Bindeglied – durch die mehreren Tausend Briefe pro Jahr, die alle beantwortet wurden!
Die Ortsgruppen wurden mit 50 Mitgliedern gegründet. Jedes Jahr wurden eine zentrale Versammlung und ein Schwabenball abgehalten. Mitarbeiter der Zentrale hielten Vorträge in den Ortschaften. Außerdem gab es auch einen regionalen Kapellen-Wettbewerb, so die Quellen. Das Zusammengehören des Deutschtums und der Gebrauch der deutschen Sprache sei immer wieder betont geworden. Zwischen 1925-1933 fanden 1691 Veranstaltungen statt (die dokumentiert sind). Nur Franz Basch alleine nahm zwischen 1925-1936 an 478 Veranstaltungen teil.
Zielgruppe dieser deutschen Bewegungen war in erster Linie das Bauerntum auf dem Lande. Grund dafür war, dass in den Städten die Assimilation leider schon weiter fortgeschritten war, so der Wissenschaftler. Später versuchte man (hauptsächlich der Volksbund), auch das Bürgertum anzusprechen.
Anfang der 30er Jahre hatte der Volksbildungsverein 28.000 Mitglieder (1931) und 192 Ortsgruppen (bis 1935). Das Sonntagsblatt hatte 12.000 Abonnenten (1933).
Den zweiten Vortrag hielt Peter Somlai (Deutsch- und Geschichtslehrer am Imre-Madách-Gymnasium Budapest) über „die Beziehungen des um Budapest lebenden Ungarndeutschtums zum Mutterland. 1920-1945”.
Wir haben erfahren, dass es ab Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Organisationen gab, die sich mit dem Auslandsdeutschtum beschäftigten, wie etwa der Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA, 1881), Deutsches Auslands-Institut (DAI, 1917) oder der Reichsverband der katholischen Auslandsdeutschen (1918)
Bis zu den 1920er Jahren sei es kaum zu direktem persönlichen Kontakt zwischen den ungarländischen und den ausländischen Bewegungen gekommen. Man bekam laut Somlai hierzulande nur von der Presse Informationen aus dem Reich bzw. aus Österreich oder vom Deutschtum der Nachbarländer. Diese übten eine enorme Kritik an Ungarns Nationalitätenpolitik, worauf die ungarische Regierung zu reagieren versucht habe. Die ungarischen Behörden machten nach Erkenntnissen von Somlai sogar Versuche die deutschsprachigen Zeitungen (und Abonnenten) zu kontrollieren (z. B. durch die Post). Schon ab den 1890er Jahren kamen immer wieder „Wandervögel”/ „Wanderburschen” (Studenten) aus dem Reichsgebiet nach Ost-Europa und diese Bewegung habe sich nach dem Ersten Weltkrieg noch weiter verstärkt. Diese Jugendlichen betonten immer die Wichtigkeit des „Volksgemeinschaftscharakters” des Gesamt-Deutschtums und brachten nicht nur Nachrichten hierher, sondern sie berichteten auch im Mutterland von den Nationalitätenverhältnissen in Ungarn (und in anderen Ländern). Die erwähnten Aktivitäten hätten Misstrauen bei den ungarischen Behörden hervorgerufen, was zu weiteren Spannungen führte, so die Forschungsergebnisse von Dr. Péter Somlai. Alles wurde nach Erkenntnissen Somlais von den Behörden beobachtet. Man habe schon darin eine Gefahr gesehen, dass das ungarländische Deutschtum sich mit Vertretern des Reichsdeutschtums trifft und von den dortigen fortgeschritteneren Verhältnissen erfährt. Von ungarischer Seite habe man aber vergeblich versucht die Ein- und Ausreisen zu verhindern, da der ungarische Staat immer stärkeren Kontakt zum Reich aufbauen wollte.
Den nächsten Vortrag hielt Reka Marchut (TK-KI) über die Sathmarer Schwaben (1940-42) in Hinsicht auf „die Einstellung der katholischen Kirche gegenüber den deutschen Minderheitenbestrebungen”. Die Referentin analysierte den Zusammenhang zwischen Ethnizität und Religion – durch welche Faktoren diese beeinflusst wurden und in welchem Ausmaß die katholische Kirche die Assimilation beeinträchtigte. (Das Thema wurde zuvor auch u. a. von den Wissenschaftlern Spannenberger, Grósz und Baumgartner bearbeitet.)
Die Historikerin behandelte die Zeitspanne zwischen dem Zweiten Wiener Schiedsspruch (1940) und dem Jahr, in dem Sathmar wieder einen eigenen Bischof bekam (1942).
Die Sathmarer Schwaben, die sich immer als „Schwaben” und nicht als „Deutsche” sahen, waren von einem Netz von ungarischen, deutschen und rumänischen Einflüssen umgeben, wozu noch die Katholische Kirche als Faktor hinzukam, so Marchut. Der rumänische Staat versuchte die Deutschen gegenüber den Magyaren zu stärken; dies ist auch an den Zahlen der Volkszählungen zu sehen, so die Forschungsergebnisse. In dieser Sathmarer Region, zu der 27 Gemeinden gezählt werden, sind 1880 – 10.376 Deutsche, 1910 – 3581, 1920 – 12.756 (RU), 1930 – 13.048 (RU), 1941 – 5615 eingetragen worden. Interessant ist, dass in Rumänien 1920 die Nationalität mit den Religionen quasi gleichgesetzt worden sei, d.h. die Katholiken wurden als Deutsche, die Reformierten als Magyaren und die Griechisch-Katholischen und die Orthodoxen als Rumänen gesehen. Schon Anfang des 20. Jh, wurde in Sathmar nur ungarisch unterrichtet und die Kirchensprache war auch Ungarisch mit deutschem Gebet. Organisiert wurden die Sathmarer Schwaben von den Banater Schwaben. (1925-26 Deutsch-Schwäbische Volksgemeinschaft). Diese forderten Unterricht und Messen in deutscher Sprache! Ihre Zeitung war die „Sathmarer Schwabenpost”, die zweisprachig, deutsch-ungarisch war.
Mit dem Zweiten Wiener Schiedsspruch kamen die Sathmarer Schwaben und die Bistritzer Sachsen zurück zu Ungarn. Der Volksbund erhielt diesbezüglich besondere Rechte, was auch im Volksgruppen-Abkommen deklariert wurde. Man wollte die fortgeschrittene Assimilation umkehren, so Marchut. Angelo Rotta, der damalige Päpstliche Nuntius sagte: „Es gibt schon genug Deutsche in Ungarn und zum Glück kamen die Sachsen (Lutheraner in Süd-Siebenbürgen) nicht zurück…” Der Druck von Deutschland wuchs. Der Volksbund erwartete eine Mitarbeit der Kirche im Sinne des Volksgruppen-Abkommens. In ihrem Vortrag redete Reka Marchut auch über die Umstände der Ermordung von Stefan Mannhercz (19. 11. 1940). Von der deutschen und der rumänischen Presse wurde damals darüber berichtet, von der ungarischen dagegen nicht… Der Volksbund nannte ihn „unseren ersten Märtyrer”. Die Gegensätze hatten sich nach Ergebnissen von Marchut zwischen den deutsch-gesinnten und den ungarisch-gesinnten Schwaben verstärkt und Mannhercz sei dem zum Opfer gefallen. Am Ende ihres Vortrags zog Frau Marchut die Bilanz: Die am Anfang aufgestellte Präkonzeption habe nicht bestätigt werden können – wegen den vielen innerlichen Brüchen (in Hinsicht auf Nationalität und Religion). Durch den „Imperium-Wechsel” – unter den neuen Umständen nach 1940 – sei nicht die Assimilation der Schwaben zum primären kirchlichen Ziel geworden, sondern die Wiederfindung und -vereinbarung der kirchlichen-staatlichen Interessen, was auch zu Gegensätzen mit der deutschen Bewegung geführt habe.
Den letzten Vortrag am Vormittag hielt Beate Márkus (Uni Fünfkirchen), mit dem Titel „Ein eigenartiges Beispiel für deutsch-deutsche Beziehungen: Ungarndeutsche in der Waffen-SS”.
Die SS – die einstige Leibstandarte – wurde im Zweiten Weltkrieg zu einer richtigen Armee ausgebaut. Dank der guten Ausrüstung, der Selektion und dem Fanatismus erlangten diese Divisionen immer wieder Kriegserfolge, wonach die Organisation immer weiter begünstigt wurde und weiter wuchs. Mit dem wachsenden Bedarf an Kriegern kamen auch andere Länder ins Bild, wo „Germanen” oder deutsche Volksgruppen lebten. Anfangs kam es (zumindest offiziell) nur zu freiwilligen Rekrutierungen. (Nach einigen Berichten passierten schon 1941 Zwangsrekrutierungen.) In Ungarn wurde die Rekrutierung ab Februar 1942 durch ein zwischenstaatliches Abkommen legalisiert (20.000 Jugendliche im ersten Jahr). Die Werbeaktionen waren laut Forschungsergebnissen am Anfang nicht besonders erfolgreich, aber es gab große Unterschiede in den verschiedenen Regionen. Zum Beispiel hätten in der Batschka sich viel mehr freiwillig gemeldet. Viele konnten ihr Deutschtum wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem gewaltigen militärischen Unternehmen erleben. Es gab mehrere Aktionen an der ungarisch-reichsdeutschen Grenze, die auf eine Grenzkorrektur zielten (1939), so Márkus. Man wollte Ödenburg, Steinamanger, Güns und dessen Umgebung dem Deutschen Reich anschließen.
Eigentlich war die Rekrutierung zu popularisieren in der Presse nicht erlaubt, dennoch waren die „Deutsche Zeitung” und der „Deutsche Volksbote” ab dem Frühjahr 1942 voll mit Lob für und Berichten über „unsere Helden” (später Heldentoten), so die Wissenschaftlerin. Die Namen und die Ortschaften wurden auch genannt.
Die Motivation sei eine interessante Frage und komplizierter als sie zwischen 1945-1990 interpretiert wurde (Nationalsozialismus). Die möglichen Motivationen:
- Neben der ideologischen Überzeugung (dank der wirksamen Propaganda) auch
- finanzielle Gründe.
- Zum ersten Mal hätten viele ungarndeutsche Jugendliche sich als Teil der deutschen Volksgemeinschaft fühlen können.
- Die vorher genannten Gründe träfen nicht auf die Zwangsrekrutierten von 1944 zu.
Nach 1945 wurden diese Leute verfolgt und es kam zu vielen Enteignungen, Gerichtsverfahren und harten Strafen. In Nürnberg wurde die SS 1946 als Kriegsverbrecher-Organisation kollektiv verurteilt. Die ehemaligen SS-Soldaten gründeten Presse-Organe und Hilfsorganisationen. Weil sie nach dem Krieg kollektiv entrechtet wurden, suchten sie noch stärker den Kontakt zueinander; sie versuchten ihre Rolle im Krieg neu zu interpretieren, so die Forschungsergebnisse. Der erste deutsche Kanzler Konrad Adenauer sagte nach dem Krieg über die SS-Männer: „Soldaten wie andere auch.”
Am Nachmittag lag der Schwerpunkt auf der Nachkriegsgeschichte. Viktória Muka von der Deutschsprachigen Andrássy-Universität Budapest widmete sich der Rolle der Landsmannschaften in Deutschland im Spiegel der Heimatvertriebenenzeitschriften „Unsere Post” (ab 1982 alleinige Zeitschrift der heimatvertriebenen Deutschen aus Ungarn) und „Heimatruf” als Quellen bzw. als damalige Plattformen für Information und Diskussion. Die junge Wissenschaftlerin betonte eingangs, dass Loyalitäten und politische Überzeugung aus der Vorkriegszeit maßgeblich bei den Landmannschaften gewesen seien. Zwei Führungsfiguren beeinflussten die politische Repräsentation der heimatvertriebenen Ungarndeutschen: Der aus Großturwall/Törökbálint stammende Ludwig Leber und der Bonnharder Heinrich Mühl.
Leber, der aus der Treuebewegung stammte, hatte doppelte Bindungen (zu Ungarn und Deutschland) und habe sich offen für alle Ungarndeutschen gezeigt. Der „deutsch fühlende” – als Kriegsverbrecher deklarierte – Mühl hingegen habe eine „deutlich radikalere” Linie gefahren und war vor dem Kriegsende Mitglied des Volksbundes, ehe er über Österreich nach Deutschland floh, wo er 1963 starb.
Der heimatvertriebene Ludwig Leber gründete neben der Caritas-Flüchtlingshilfe mit Sitz in Stuttgart auch die Zeitschrift „Unsere Post”. Mit Lebers Namen ist auch die Gründung erster landsmannschaftlicher Organisationen (Ungarndeutsche Landsmannschaft) verbunden. Auf der anderen Seite gründete der Kreis um Mühl das evangelisch geprägte Hilfskomitee mit Sitz in Augsburg und Ablegern in den Bundesländern. Sie bemühten sich nach Worten von Muka um die Etablierung von Gegen-Landsmannschaften (Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn), aber lediglich in Hessen mit Zentrum in Darmstadt seien diese Bemühungen erfolgreich gewesen. Hier bezog sich Muka auf die Forschungstätigkeit von Krisztina Kaltenecker, auch im Sonntagsblatt ist eine Studie dieser Wissenschaftlerin erschienen (Der Darmstädter Schwabenball der 1950er Jahre als Zankapfel zwischen den gemäßigten und den radikalen „Deutschbewussten“, SB, 02/2022).
Wichtige Namen in diesem Zusammenhang waren auch Friedrich Spiegel-Schmidt und Heinrich Reitinger. Der Kreis um Mühl habe aus ehemaligen Volksbund-Mitgliedern bestanden, sie hätten die Zugehörigkeit zum deutschen Volk betont und nach einer starken Integration gerufen, was eine Loslösung von der alten Heimat bedeutet hätte. Sie hätten betont, dass es für ehemalige Mitglieder der Treuebewegung kein Platz gäbe. Verbunden mit dieser Bewegung war die Donausiedlung Darmstadt unter der Leitung von Irma Stein, wo sich Donauschwaben evangelischen Glaubens aus Ungarn niederließen. „Heimatruf” diente als Sprachrohr des Kreises, dem sich auch Dr. Johann Weidlein anschloss, den Muka als antimadjarisch beschrieb – als einen, der die „Kulturhoheit der Deutschen” vertreten habe.
Auch in anderen Bereichen seien die Meinungen der beiden Führungsfiguren auseinandergegangen: So sei Leber gegen einen Beitritt der Landsmannschaft in den Bundesverband der Heimatvertriebenen gewesen, wohingegen sich Mühl dafür ausgesprochen habe. Leber habe die Vertreibung mit dem „Potsdamer Diktat” erklärt, Mühl habe sie als „chauvinistische Aktion der Madjaren” betrachtet. Auch bezüglich Bleyer hätten sich die Geister gestritten: So habe Mühl den Einsatz Jakob Bleyers für die deutsche Sprache und deren Position im Schulwesen unterstrichen, wohingegen Leber die Hungarus-Idee des früheren Professors und Ministers betonte.
In der Folge wurden sowohl Mühl als auch Leber Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, was eine Annäherung bedeutet habe, so Muka. Dennoch blieben die grundlegenden ideologischen Unterschiede. Die Bonner-Dokumente von Theodor Schieder hätten dabei Lebers Position gestärkt, was den Bedeutungsverlust der Mühl-Gruppe verstärkt habe.
Dr. Ágnes Tóth, Forschungsprofessorin am Institut widmete sich den Beziehungen zwischen dem Deutschen Verband in Ungarn und den Landsmannschaften in Deutschland, die erst 1980 fusionierten und fortan den Namen Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) trugen. Die erste informelle Kontaktaufnahme sei auf Anfang der 1960er Jahre datiert und zwar in Form von Besuchen in deutschen Dörfern sowie der Kontaktsuche in Ministerien und Zeitungen, so Tóth.. Auch zu Generalsekretär Friedrich Wild, der wie die Verbandsspitze trotz Liberalisierungstendenzen weiterhin unter Druck gestanden sei, entstanden informelle Kontakte; in den Gesprächen sei es um die Schulfrage und die Situation der Kulturgruppen gegangen. Im Januar 1969 fand das erste offizielle Treffen statt; hier trafen sich die Landsmannschaftler, die bis dahin zahlreiche Studienfahrten absolviert hatten – auch mit Vertretern des Schulministeriums. In diesem Zusammenhang wurde Wild nach Backnang eingeladen. Er durfte dieser Invitation aber nicht folgen, was ihn zur öffentlichen Kritik veranlasst habe; in diesem Rahmen habe er auch die Verweigerung von Auslandsreisen für ungarndeutsche Kulturgruppen thematisiert. Die ungarndeutsch-vertriebenendeutschen Beziehungen seien die ganzen Jahrzehnte den deutsch-ungarischen Außenbeziehungen untergeordnet gewesen, auch wenn die Landsmannschaft Lobbyarbeit betrieben habe. Insgesamt sprach Dr. Ágnes Tóth von „asymmetrischen Beziehungen” aufgrund der deutlich günstigeren wirtschaftlichen Lage der vertriebenen Ungarndeutschen. Die Wissenschaftlerin betonte in ihrem Vortrag, dass die Erforschung dieses Kapitels ungarndeutscher Geschichte auch aufgrund der überschaubaren Quellenlage noch in den Kinderschuhen stecke.
Der aus Schaumar/Solymár stammende Historiker Georg Ritter beschäftigte sich in seinem 20-minüten Vortrag mit der Gründung der LPGs im Kontext des Schicksals der deutschen Volksgruppe. Er stützte sich dabei auf 132 Interviews, die er in 64 Gemeinden geführt hatte, sowie auf die Unterlagen des Landwirtschaftsministeriums und auf Presseberichte.
Die sozialen Verhältnisse unter den verbliebenen Deutschen und den „Telepesek” seien Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre sehr ähnlich gewesen, dennoch sei selbstständige landwirtschaftliche Tätigkeit eher für die Deutschen charakteristisch gewesen, die viel eher eigene LPGs gründeten (wenn sie in der ersten Kollektivierungswelle überhaupt bereit zum gemeinschaftlichen Wirtschaften bereit waren); dies treffe insbesondere auf die erste der drei Phasen der Kollektivierung in den Fünfzigern zu. Auch madjarische LPG-Vorsitzende hätten sich gerne auf die Schwaben gestützt. Die Kollektivwirtschaften selbst hatten drei Typen und nur Typ 3 sei eine richtige Kolchose gewesen, die ersten beiden Mischformen. Ziel der politischen Führung war nach Ansicht Ritters vor dem Hintergrund der Förderung der Schwerindustrie das Brechen des Rückgrats der Wirtschaft in der ungarischen Provinz.
Dabei habe es schwabendominierte LPGs und LPG-Gruppen gegeben, so Georg Ritter, der die Mitgliederlisten studiert hatte: So wurden in die LPG vom Typ 3 „Előre” (Vorwärts) in Závod 105 von 145 Joch Acker von Ungarndeutschen eingebracht; auf der Liste finden sich nur zwei ungarische Familiennamen. Auch in Saar/Szár, Pußtawam/Pusztavám, Moor/Mór, Ödenburg und Fünfkirchen gab es deutschdominierte LPG-Gruppen, die jedoch nach den Forschungsergebnissen von Ritter erst nach der Etablierung der LPGs der „telepesek” gegründet werden durften. Aber auch die Madjaren betraf die Ethnisierung der LPG-Gründungen: So hieß eine LPG-Gruppe in Tschatali/Csátalja „Első Felvidéki tszcs.”, also Erste Oberungarische LPG-Gruppe. Auch zwischen Schwaben und Schokatzen kam es zu Zusammenarbeit und Gruppengründungen. Von den Leistungen der Deutschen sei die Presse überwältigt gewesen, obwohl sie wenige Jahre zuvor noch andere Töne angestimmt hatte. Die zweite, aber insbesondere die dritte Kollektivierungswelle habe dann beide Gruppen – heimatverbliebene Deutsche und „telepesek” – durch das Erlebnis der kollektiven Entrechtung zusammengebracht, was auch eine Annäherung auf der Ebene der Familien bedeutete: So fielen die ersten Mischehen in diese Zeit.
Für den letzten Vortrag des Nachmittags zeichnete Levente Szilágyi verantwortlich. Er berichtete über die grenzüberschreitenden Beziehungen der Sathmarer Schwaben. Wallei/Vállaj und Schinal/Urziceni/Csalános dienten Szilágyi bei diesem Thema als Referenzgemeinden. Nach jahrhundertelangen wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Beziehungen waren dort durch den Trianon-Vertrag gewachsene Strukturen zerrissen worden. Um das zu kompensieren, hätten sich die Bewohner unterschiedlicher Praktiken bedient u. a. bei der Partnerwahl und der Pflege verwandtschaftlicher Verpflichtungen. Dabei betrachtete Szilágyi einen Zeitraum zwischen 1920 und der Gegenwart. Szilágyi dienten bei seiner Arbeit wie Georg Ritter Archivquellen und auch Interviews.
1922-39 bedeutete die Bewirtschaftung der zerrissenen Ackerstücke die wichtigste Frage für die Bewohner beider Gemeinden. Dabei wurden ihre Besitzrechte laut Szilágyi nicht berührt: Man konnte mit speziellen Passierscheinen die Grenze jeden Tag überqueren. Die rumänischen Behörden stellten aber immer mehr Hürden auf. Das führte dazu, dass der Bodenbesitz Gegenstand von Tauschgeschäften wurde. Die Hoffnung einer Grenzkorrektion habe aber nie aufgehört zu bestehen.
1947 wurde das Grenzregime verschärft und blieb so bis zur Aufnahme des kleinen Grenzverkehrs in den 1960ern und 1970ern. Dennoch berichtete der Forscher, dass das Schicksal der Familienmitglieder jenseits der Grenze über die Jahrzehnte hinweg dank eines Informationsnetzes von den Verwandten jenseits der Grenze verfolgt worden sei – jedenfalls formal. Kontaktmöglichkeiten hätten sich auch durch Feldarbeiten an der Grenze ergeben oder über Nachrichtenübermittlung in Zigarettenschachteln, die über die Grenze geworfen worden seien. Die Wendezeit habe ein „ethnisches Erwachen” gebracht: Partnerschaften, Vertiefung verwandtschaftlicher Beziehungen über Besuche und Veranstaltungen wie Kirmes oder Strudelfestival in Wallei. Dabei spielte die Kirche stets eine wichtige Rolle: So gaben religiöse Anlässe den Ausschlag für die Kontaktpflege. Auch die Malenkij Robot-Gedenkstunden hätten Gelegenheit für Treffen beiderseits geboten, hier sei die rumänische Seite Vorreiter gewesen.