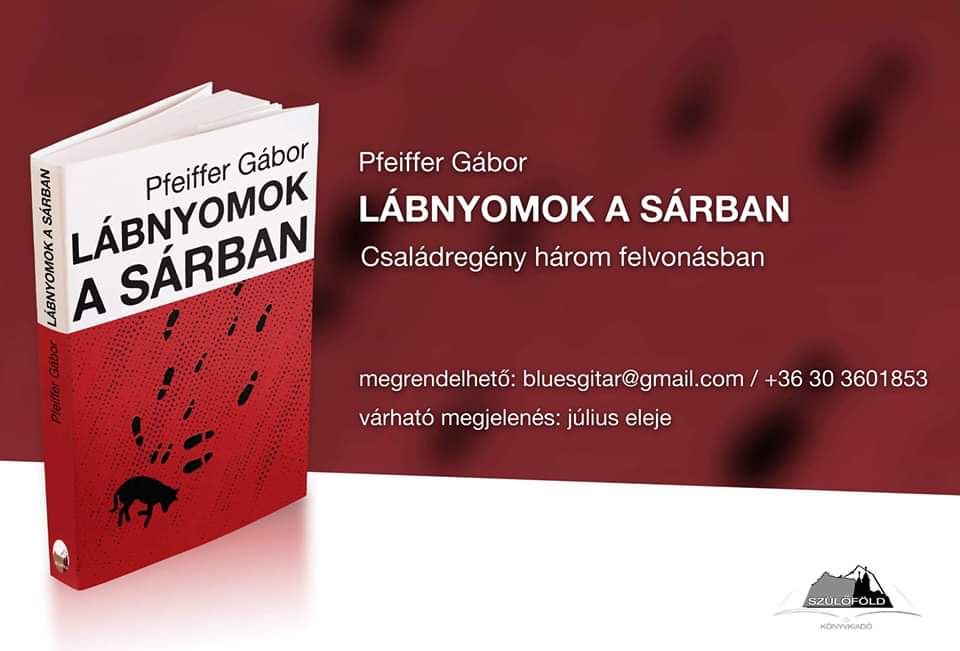SB: Sie sind gerade mit einem Roman fertig geworden, der den Titel „Fußspuren im Matsch” trägt. Was hat Sie dazu bewogen die Pfeiffer-Familiengeschichte in dieser Form zu verarbeiten?
GP: Ehrlich gesagt habe ich mich früher nicht wirklich mit der Vergangenheit meiner Familie und meines Heimatdorfes Tscholnok/Csolnok beschäftigt. Ich habe von meinen Eltern und Großeltern in meiner Kindheit wohl Geschichten gehört, aber diese berührten mich damals nicht wirklich. Beim Urlaub – vor etwa vier Jahren – habe ich eine fünfköpfige deutsche Familie erblickt. Der Junge, der dabei war, erinnerte mich an ein anderes Kind aus der Verwandtschaft. Erst habe ich mir vorgenommen, dem Lebenslauf dieses Kindes zu folgen. Es kam aber anders. Aber als ich dann doch Nachforschungen angestellt habe, kamen mir die vor langem gehörten Geschichten wieder in den Sinn. Der Roman selbst besteht aus drei Teilen. Alles hat einen Tatsachenkern, aber die Geschichte enthält auch fiktionale Elemente. Beim ersten Teil geht es um die Lebensgeschichte um den jüngeren Bruder meines Großvaters väterlicherseits. Er verschwand in der Ukraine. Wir wissen nicht viel über ihn. Dieses Kapitel ist meist fiktional. Natürlich taucht in der Geschichte natürlich der Alltag im damaligen schwäbischen Dorf auf. Es geht dabei um Liebe, Krieg, Freundschaft, Geburt und Tod. Beim zweiten Teil des Romans geht es um die Geschichte der jüngeren Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits. Dieser Teil fußt auf mehr Tatsachen. Diese Schwester heiratete einen Wudigesser und wurde von dort mit vier weiteren Familienmitgliedern vertrieben. Eine Reihe tragischer Ereignisse erwartete sie in der neuen Heimat. Zum Glück hat einer ihrer Söhne vieles aufgezeichnet, deshalb hatte ich bei diesem Kapitel ein leichteres Spiel. Der dritte Teil des Romans beschreibt schließlich den Deutschlandbesuch meiner Eltern im Jahre 1965. Ich habe recht viel geforscht, damit das Buch, soweit möglich, authentisch wirkt. Viele der Information waren neu für mich. Und ich denke, sie werden auch für viele anderen neu sein. Womöglich werden auch einige Politikernamen überraschend vorkommen. Ich wollte keinen Roman schreiben, der die Ereignisse dokumentiert, sondern vielmehr ein Lebensgefühl vermitteln, nichtsdestotrotz enthält das Werk unzählige konkrete Angaben zum historischen Hintergrund. Jedoch Dienerschaft, Holocaust, Kirmesball, SS-Rekrutierung, Gefangenenlager, der Sozialismus der 1960er Jahre…
SB: Wie haben Sie das ungarndeutsche Dasein selber erlebt?
GP: Ich habe bereits als Kindergarten- bzw. Grundschulkind Deutsch gehabt. Mein Bruder hat erst im Kindergarten Ungarisch gelernt. Bis dahin sprach er nur Schwäbisch, die Sprache in der Familie. Meine Großeltern trugen noch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die Volkstracht. Ich selbst fühlte mich – was ich ein wenig bedauere und wofür ich mich schäme – in meiner Kindheit und Jugend kaum mit dem Schwabensein verbunden. Die Zusammensetzung der Bevölkerung hatte sich in der Zwischenzeit bedeutend verändert. Ich habe auch eine Nichtschwäbin geheiratet. Leider Gottes sprechen meine Söhne kein Deutsch, obwohl sie diese Sprache 12 Jahre lang gelernt haben. Daran bin ich auch schuld. Trotzdem ist bei uns die deutsche Identität immer noch sehr stark, weil es viele Kulturgruppen gibt, die die Traditionen pflegen. In der Umgebung gilt Tscholnok immer noch als schwäbisches Dorf.
SB: Sie sind Musiker, allerdings gehört Blues nicht zu den traditionellen ungarndeutschen Musikinstrumenten – hatte das musikalische Leben in Tscholnok dennoch einen Einfluss darauf?
GP: Mein Bruder hat einige Jahre Trompetenunterricht in der örtlichen Großkapelle genommen, aber diese Art von Musik hat mich nie fasziniert, auch jetzt stehe ich nicht wirklich auf Schrammelmusik. Obwohl ich die Bläser in meiner Musikrichtung durchaus mag. Bereits früh habe ich Rock und Blues gehört. Ich war, glaube ich, fünf Jahre alt, als ich eine Spielgitarre bekommen habe. Ich wollte schon immer Gitarre spielen und singen, obwohl Singen mittlerweile nicht mehr Teil meines Alltags ist. Im Übrigen ist das musikalische Leben im Dorf sehr rege. Es gibt Blaskapellen, Chöre und Tanzgruppen.
SB: Wie sehen Sie die gegenwärtige Lage der Ungarndeutschen in Tscholnok und anderswo?
GP: Ich denke, wenn jemand sein Schwabensein erleben möchte, kann er das auch. Die Kinder lernen in der Nationalitätenschule Deutsch und es gibt unzählige Gruppen in Tscholnok, die die Traditionen bewahren wollen. Leider tat die Politik der Nachkriegszeit, egal welchen Couleurs, dem Verhältnis zwischen Schwaben und Madjaren nicht gut, aber das spürt man heute nicht mehr. Auch darüber schreibe ich in meinem Roman. Hin und wieder, von hie und da höre ich despektierliche Äußerungen, aber ich denke, das ist heute nicht mehr allgemeingültig.
SB: Sie haben sechs Jahre in Österreich, im deutschsprachigen Umfeld verbracht – welchen Einfluss hatte es auf ihre (ungarndeutsche ) Identität?
GP: Da ich Mundart spreche, dachten in Österreich viele, dass ich die Sprache sehr gut beherrsche, was anfangs nicht ganz stimmte. Es war aber eine gute Gelegenheit, um meinen Wortschatz aufzufrischen. Ein Beispiel: Ganz am Anfang fragte mich in Innsbruck ein Kollege von mir, seit wann ich dort arbeite. Ich zeigte mit dem Finger: seit zwei. „Seit zwei Jahren?”, fragte er? „Nein”, sagte ich, „seit zwei Monaten.” In meiner letzten Arbeitsstelle gab es einen Mazedonier, der seit seiner Kindheit in Österreich lebte. Er hat mich oft korrigiert, weil er nur Hochdeutsch sprach. Es ist witzig, mein jetziger Chef in Ungarn ist ein deutscher Herr, der meint, ich würde österreichisch sprechen. Ich habe eine beachtliche Karriere mit meinen lückenhaften Sprachkenntnissen durchlaufen. Da ich in dem Umfeld eher akzeptiert wurde als Söhne von anderen Nationen oder waschechte Madjaren, habe ich mich gefreut und war stolz, dass meine Eltern und Großeltern mir damals das Schwäbische beigebracht haben. Ich fühlte mich wie ein Verwandter unter ihnen. Vielleicht spielte es mit eine Rolle, dass ich mit dem Romanschreiben begann.
SB: Wir haben bei der Vergangenheit begonnen, werfen wir deswegen einen Blick in die Zukunft: Wie sehen Sie die Zukunft der Deutschen in Ungarn?
GP: Ich denke, wir haben in unserer Heimat alle Möglichkeiten, um unser Schwabensein zu erleben. Vielleicht – unsere parlamentarische Vertretung ist nicht gelöst. Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch dazu beitragen kann, dass unsere Vergangenheit, Bräuche und Sprichwörter nicht in Vergessenheit geraten. Das Motto meines Buches lautet ja: „Manch einem wird mehr, man einem weniger Zeit auf Erden zuteil“. Dennoch hinterlässt jeder Spuren in uns und der unendlichen Geschichte. Es kann vorkommen, dass wir nur für Tage oder Monate im Leben eines anderen auftauchen, aber durchaus auch, dass wir zu Weggefährten, Partnern und Freunden eines anderen werden. Es gibt Menschen, denen nur ein-zwei Jahrzehnte gegönnt werden und die das Gefühl haben, nichts hinterlassen zu haben. Es gibt aber solche, denen wesentlich mehr Zeit gegönnt ist, aber dennoch meinen, ein langweiliges Leben zu führen. Es gibt welche, die nur ein Gedicht hinterlassen und welche, die ein Lied und wiederum welche, die ein Haus, mit den eigenen Händen gebaut oder einen Nussbaum, eigens gepflanzt. Wenn wir selbst keine guten Menschen waren, hinterlassen wir ein talentiertes Kind oder Enkelkind – unauslöschbar. Sinnlos wird keiner geboren. Jeder hat irgendeine Mission, auch wenn wir uns darüber im Moment unseres Todes nicht im Klaren sind. Obwohl die Helden meiner Historie stürmische Zeiten erlebt haben, dürfen wir nicht vergessen: Jede Zeitepoche ist historisch. Denken wir daran, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben keinen Sinn hat. Auch wenn die Zeit das Andenken an uns hinwegfegt wie die unbarmherzigen Wellen des Meeres die im Sand hinterlassenen Fußspuren, sind diese da gewesen und wenn auch nur ein wenig haben sie Welt verändert. Wir werden geboren, wir lieben, hassen, genießen, leiden, legen uns schlafen, stehen auf, machen Liebe, streiten uns, unterhalten uns, arbeiten, verdienen Geld und geben dieses aus, führen Kriege, schließen Frieden, umarmen uns, stoßen uns gegenseitig ab, man passt auf uns auf und wirft uns weg, wir ärgern uns, sind glücklich, weinen, lachen, beeilen uns, ruhen uns aus, akzeptieren, lehnen ab, bauen, zerstören, fügen Wunden zu, heilen, sind treu, betrügen, sind gut, böse, schön, hässlich, leben und sterben, sind Menschen und hinterlassen nach dem Regen im Matsch unsere Fußspuren.
____________________________________________
Auszug aus dem neuen Roman „Fußspuren im Matsch” (Lábnyomok a sárban) von Gábor Pfeiffer, Tscholnok. Deutsche Übersetzung: Richard Guth
Josef, Rosa, auf ihrem Rücken im Tuch eingewickelt Michael, Elisabeth, der alte Hoffer und zwei ältere Jungs fanden Platz auf dem Plateau eines Militärfahrzeugs. Um sie herum ihr Hab und Gut, was sie schnell zusammentragen konnten. Am Vortag goss der Frühlingsregen wie aus Eimern, ununterbrochen, ohne ihn trösten zu können. Erst spätnachts ließ er nach. Frühmorgens waren Hof und Straße voller Pfützen und Matsch. Rosa verpackte, auf entschlossene Anweisung ihres Mannes hin, selbst das von Frau Frida geschenkte Kaffeeservice. Als ob sie auf ihrer Reise das am Nötigsten hätten! Die Jungs verstanden nicht wirklich, wohin die Reise führt, aber da alle weinten, taten sie dasselbe, während sie ihr Lieblingsspielzeug an sich pressten. Die Straße verlor sich allmählich zwischen den Bäumen der Allee, aber sie sahen noch in der Kurve, wie Gastl, der Hirt, die Herde auftrieb und wie sich die Gänse in den Pfützen auf der Wiese vor dem Haus mit gekräuselten Federn wuschen. Josef hatte sich bemüht, seine Frau zu beruhigen: „Es wird alles gut, Rosa. Glaub mir! Wir gehen nicht zu Fremden. Wir bekommen ganz sicher eine schöne Wohnung, wir sind ja doch Deutsche! Einen guten Schuster braucht man auch dort. Deutsch sprechen wir alle gut. Über kurz oder lang werden wir die Kurve kriegen, das wirst du schon sehen. Später, wenn wir ein Stück Land erwerben können, dann werden wir wieder Wein anbauen. Denk an die, die man zu den Russen verschleppt hat. Sie müssen Zwangsarbeit leisten. Uns erging es auf alle Fälle besser. Im Vergleich zu ihnen werden wir wie Herren leben. Ich verspreche, dass du auch ein Bad haben wirst! Kormosch lief ausdauernd, hechelnd ihnen hinterher. Die Jungs wollten dieses arme Viech auf jeden Fall mitnehmen obwohl ihre Mutter beteuerte, dass dies nicht möglich wäre, weil die Genehmigung dazu fehle. Johann löste sich mit Gewalt aus den Armen seiner Mutter und sprang vom Wagen. Seine Patschker – die er an Weihnachten voller Stolz anzog, wohlwissend, dass sie von seinem Vater in Handarbeit angefertigt worden waren… – er sank im Matsch bis zu den Knien ein. Er umarmte den Hund und hielt ihn verkrampft, weinend und zitternd fest. Der Verzögerung wurde von einem ungeduldigen Wächter ein Ende gesetzt. Er entriss dem Kind den Hund, schob Johann beiseite, zog das Gewehr und schoss auf das Tier. Der Hund fiel mit einem leisen Wau um. Ungewollt trat er noch zweimal mit seinen Hinterbeinen, bis er sich bewegungslos ausbreitete. Das Ganze dauerte weniger als ein paar Sekunden. Der Bewaffnete trat zum Abschied seine verdreckten Stiefel am Kadaver ab. Das konnte Josef nicht mehr zulassen. Er sprang vom Wagen und spuckte dem Wärter ins Gesicht. Er schnappte sich den Jungen und kletterte auf das Plateau. Rosa zog verschreckt das weinende Kind zu sich. Die winzigen Fußspuren von Johann blieben im Matsch zurück. Mehr haben sie nicht hinterlassen, bis auf den Kadaver von Kormosch, der allmählich auskühlte. Der Hundemörder drohte weiter mit seiner Waffe und fluchte lange. Josef versuchte erneut, Rosa zu beruhigen: „Weine nicht, Rosa! Es wird uns gut gehen in der neuen Heimat! Ich wollte eigentlich schon immer da hin. Erinnerst du dich, dass wir einmal drüber sprachen, einst dorthin zu ziehen?! Natürlich war es nicht ganz so geplant. Aber wenn es so gekommen ist, dann sehen wir die gute Seite der Sache!” Aber jedes Wort war umsonst. Dieser ruhmlose Tag fiel auf den 19. März 1946, als sie ihre ungarische Staatsbürgerschaft verloren haben. Als wir in Kleinturwall ankamen, war der Bahnhof bereits mit Menschen gefüllt, die das gleiche Schicksal geteilt haben. Der Nachbar Koller und seine Familie mussten mit der eigenen Kutsche das innig geliebte Heimatdorf verlassen. Der Fuhrmann fiel an den Gleisen wie ein Kind weinend ins Gesicht seiner Pferde, während er mit beiden Händen an deren Haaren streichelte. Die Soldaten trieben ihn mit Schlägen von den Tieren fort. Csillag blickte den Schotterstein tretend, seinen Kopf senkend und dann wieder aufrichtend, mit traurig schimmernden Augen seinem Besitzer hinterher. Josef sah zum ersten Mal in seinem Leben ein Pferd, das weinte. Nach Erzählungen der Verbliebenen haben diese Tage jeden zutiefst erschüttert. Diejenigen, die – warum auch immer – bleiben konnten, und die im Dorf verbliebenen Madjaren beobachteten erschüttert, unter welchen Umständen ihre Verwandten, Bekannten und Familienmitglieder aufbrachen. Genauso herzzerreißend war der Anblick der verlassenen Höfe. Es war schwer, in der Atmosphäre von Angst und Misstrauen das gewohnte Leben fortzuführen. Das Dorf verlor einen Großteil seiner Bewohner. Die „Mitarbeiter” des Amtes für Volksfürsorge plünderten die leeren Häuser und viele wurde wieder bezogen. Später wurden die herrenlosen Höfe und Böden unter den anstehenden, aus Siebenbürgen und dem ehemaligen Oberungarn Zwangsumgesiedelten verteilt. Es ist heute schwer vorstellbar, was für ein Verhältnis zwischen den Alteingesessenen und den „telepesek” entstand. Sie hatten auch nicht hierherkommen kommen wollen. Auch ihnen war Haus und Grund genommen worden. Die traumatisierten Altbewohner sahen jedoch in ihnen nur Eindringlinge. Es dauerte lange, bis sich die Situation normalisierte. Viele der nach Deutschland Deportierten konnten ihre Verwandten nie mehr wiedersehen und das Glockengeläut von Wudigess nie wieder hören.
__________________________________________________________________
Das Buch ist in ungarischer Sprache erschienen. Zu beziehen beim Autor über die E-Mail-Adresse bluesgitar@gmail.com oder die Mobilfunknummer +36303601853. Öffentliche Buchvorstellung am 1. August 2020, 14:30 im Café und Bistro „Dióhéj“ in Schambek/Zsámbék.