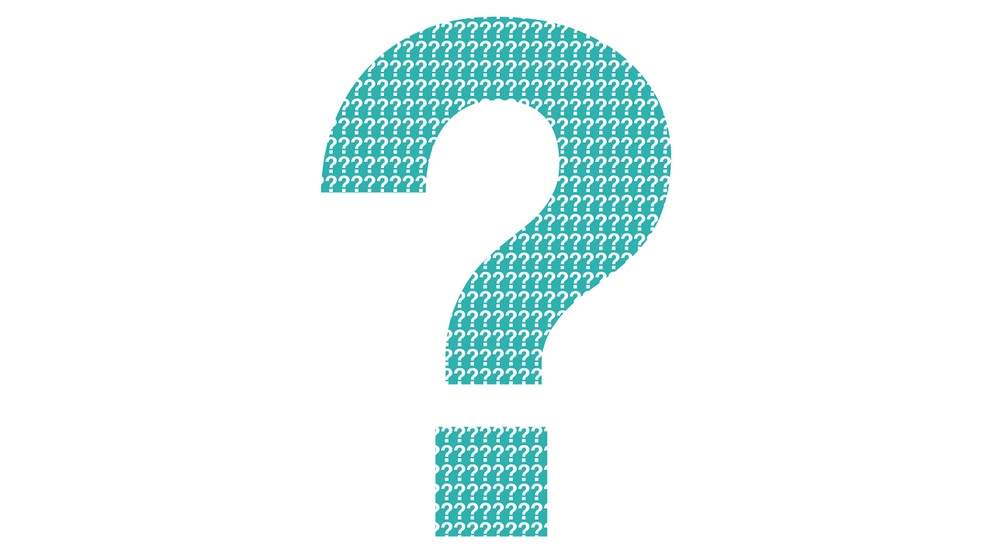Von Richard Guth
In der jüngsten Ausgabe des Sonntagsblattes, die hoffentlich jede werte Leserin, jeden werten Leser von uns erreicht hat, berichtet unser Redaktionsmitglied Patrik Schwarcz-Kiefer über das allmähliche Verschwinden der Schwaben in der Ost-Branau (Der Beitrag ist online bereits Anfang Mai erschienen: https://sonntagsblatt.hu/2020/05/01/consummatum-est-so-verschwindet-aus-den-doerfern-das-schwabentum-in-der-branau/). Er bezieht sich im Artikel auf Angaben der Gemeindeverwaltungen aus den 1950er und 1980er Jahren und spricht von einem deutlichen Rückgang der Zahl der Deutschen in der Region. Besonders deutlich war der Rückgang bis 2011: Dreiviertel der Deutschen ist in den 60 Jahren verschwunden. Schwarcz-Kiefer führt das Verschwinden der Deutschen in der Ostbranau auf die Assimilierung und negative Migrationsbewegungen zurück.
Sommerzeit bedeutet für mich immer die Gelegenheit, Sachbücher in die Hand zu nehmen, die sich unter anderem der ungarndeutschen Geschichte (in ihrer gegenwarts- und zukunftsrelevanten Dimension) widmen. Per Zufall (wie so oft) erreichte mich eine Publikation des Bonnharder Historikers und Museologen Dr. Zoltán Szőts aus dem Jahre 2007, in der dieser die interethnischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht (A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig.- Bonnhard-Sexard 2007). Der Kreis Talboden (ung. Völgység) im Komitat Tolnau wies bis Ende des Zweiten Weltkriegs den höchsten Anteil an Deutschen im ganzen Land auf: Die deutsche Minderheit stellte Dreiviertel der Einwohnerschaft. Das Ende des zweiten Weltbrennens veränderte das Bild der Landschaft nachhaltig: Nach Flucht und Vertreibung kamen Bukowina-Sekler, Madjaren aus dem ehemaligen Oberungarn und Madjaren aus Ostungarn in den Talboden. Dass diese „neue Landnahme” nicht friedlich verlief (waren die Bukowinasekler und Madjaren aus der Slowakei selbst Heimatvertriebene und/oder Flüchtlinge), zeigen die Namen Lendl/Lengyel (Internierungslager für Deutsche) und György Bodor (der die Ansiedlung der Sekler koordinierte).
Dennoch verblieb in einigen Ortschaften des Talbodens wie Kleindorog/Kisdorog, Lendl/Lengyel und Tewel/Tevel eine bedeutende deutsche Bevölkerung, so dass Anfang der 1950er Jahre noch Ortschaften mit deutscher Bevölkerungsmehrheit gab. Alles natürlich ein Ergebnis von Zahlenspielen auf Grundlage der Ergebnisse der letzten Volkszählung von 1941 und der Zahl der Geflüchteten und Vertriebenen, denn die Volkszählungsergebnisse von 1949 konnten kein realistisches Bild liefern. Der Rückgang bis 1980 war enorm (hier sprach man von „einer Bevölkerung mit deutschen kulturellen Ansprüchen”): in Kleindorog fast 50 % (von 776 auf 362 Personen), in Lendl 13 % (von 237 auf 206 Personen und in Tewel 49 % (von 577 auf 295 Personen). Als Vergleichsort wird die Branauer Gemeinde Ofalla/Ófalu genannt, die von der Vertreibung verschont blieb: Hier blieb der Anteil der Deutschen bei über 80% (bis heute), jedoch verlor das Dorf lange ohne feste Anbindung an das Straßennetz zwischenzeitlich einen Großteil seiner Bewohner. In den drei genannten Dörfern sank der Anteil der Bewohner mit „deutschen kulturellen Bindungen” bis 2001 auf 10-15 % (Kleindorog: 16 %, Lendl: 9,9 % und Tewel: 10,1 %). In den restlichen untersuchten Gemeinden (Warasch/Bonyhádvarasd, Sawed/Závod, Mutschwa/Mucsfa, Jerewe/Györe, Kleinwecken/Kisvejke) lag der Anteil dieses Peronenkreises deutlich unter 10 % (zwischen 0,9 und 7,3 %). Die Volkszählung von 2011 bestätigte in etwa diese Zahlen (mit einer Zunahme): Kleindorog mit 21,5 %, Lendl mit 14,5 % und Tewel mit 10,6 %. Interessanter gestalteten sich die Zahlen in verloren geglaubten Ortschaften: In Warasch ein Anstieg auf 17,4 %, in Sawed auf 19,8 %, in Kleinwecken auf 30,9 % und Jerewe auf 2,4 %. In Mutschwa gab es hingegen einen Rückgang von 6,1 auf 2,7 % innerhalb von zehn Jahren.
Die Zahlen zeigen große Schwankungen – und dies ist nicht nur auf mögiche Migrationsbewegungen in der Zwischenzeit oder die Problematik externer Rahmenbedingungen zurückzuführen. Eine ebenso wichtige Rolle dürfte der hohe Anteil von Mischehen spielen: In manchen Orten wurden nach Angaben von Zoltán Szőts bereits 1948 binationale Ehen geschlossen, in anderen Orten (wie in der geschlossenen Dorfgemeinschaft von Ohfala) erst Mitte der 1960er Jahre. Aus dem Studium von slowakeimadjarischen Monografien mit soziologischem Schwerpunkt weiß ich, dass Kinder, die in Mischehen aufwachsen, eher die Nationalität des Elternteils annehmen, der der Mehrheitsbevölkerung angehört (von der sprachlichen Assimilierung ganz zu schweigen). So bedeutet heute Deutsche(r) in Ungarn zu sein eine ethnisch-kulturell und sprachlich vielfach gemischte Herkunftsgeschichte, was uns vor Herausforderungen stellt – aber es ist ein Faktum, womit wir umgehen müssen. Es werden vielfach Stimmen laut, die eine eindeutige Festlegung fordern: Deutscher oder Madjare/Sekler. Eine schwierige und ganz private Entscheidung. Selbst die Zahlen sprechen dabei keine eindeutige Sprache – ein Auf und Ab ohne feste Identitätsmuster.
Welche Rolle käme dabei der ungarndeutschen Öffentlichkeit, den Führungspersönlichkeiten zu, im Falle einer so fragmentierten ungarndeutschen Gemeinschaft mit unterschiedlichen Identitätsmustern? Allen voran sollten sie diesen Menschen das Gefühl geben, dass sie genauso dazugehören als Menschen, die nur deutsche Vorfahren aufweisen und das Glück oder Schicksal hatten, die deutschen Muttersprache bewahren zu können. Aber genauso sollten diese Erwartungen formulieren – selbst einer mittleren Alters sollte in der Lage sein, seine Komfortzone zu verlassen und die verlorene Großmuttersprache zu erwerben und diese dann aktiv einzusetzen. Gewissermaßen als Multiplikator, der anderen als Vorbild dienen kann. Dies soll nicht zwangsläufig die Aufgabe der Bekenntnis zum andersnationalen Erbe bedeuten (zumal es eine illusorische Erwartungshaltung wäre), dafür gibt es zuhauf Beispiele außerhalb der Landesgrenzen von Ungarn – Menschen aus ethnisch-sprachlich-kulturell gemischten Familien, die sich für die Belange der jeweiligen deutschen Minderheit einsetzen. Eine Bringschuld haben auch der ungarische Staat und die ungarndeutschen Repräsentanten, denn wir sind noch weit entfernt vom Ausbau der kulturellen Autonomie. Genauso wichtig wäre die gezielte Wirtschaftsförderung der ländlichen Regionen – eine Erkenntnis, die man auch in der Slowakei mehrfach zur Sprache gebracht hat.