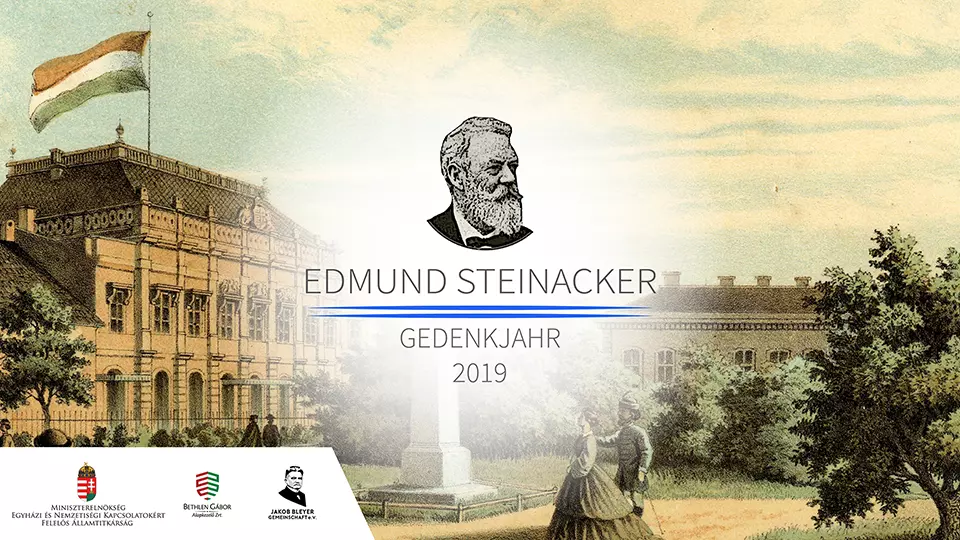Teil 2
Die Jakob Bleyer Gemeinschaft erklärte das Jahr 2019 zum Steinacker-Gedenkjahr (Sonntagsblatt 2/2019)
Als Abschluss des Steinacker-Jahres eine Zusammenfassung
Von Georg Krix / Harold Steinacker
Das Urbild des Deutschungarn
Der terminus technicus „Deutsch-Ungar” – 1641 zum ersten Mal von dem Käsmarker Bürger David Frölich gebraucht – fand zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine politische Anwendung, nämlich im Sinne des übernationalen, geographisch gemeinten patriotischen Hungarus-Bewußtseins. Die ungarische Nation setzte sich damals aus Angehörigen vieler Völker zusammen, die sich jedoch alle als „Hungari“ bekannten.
Wie kaum ein zweiter war Edmund Steinacker eine Verkörperung dieses Begriffs. Zunächst stand er ganz im Banne des patriotischen Reformliberalismus seiner oberungarischen Verwandtschaft. Sein Onkel Paul Westher schrieb seinen Namen als kossuthistischer Abgeordneter in Veszter um und ließ seinen Sohn Arpád taufen; sein Onkel Sándor geriet als Honvédhauptmann 1848 in Gefangenschaft, weil er am Wiener Aufstand teilgenommen und vom Turm der Stephanskirche der gegen Schwechat vorrückenden ungarischen Armee Signale gegeben hatte. Auf einer Reise, die über den Branisksopaß führte, ließ ihn der Onkel in Erinnerung an die tollkühne Erstürmung dieser Passhöhe 1849 durch die ungarischen Revolultionstruppen niederknien und den Schwur tun, stets die Feinde der ungarischen Freiheit zu hassen. Noch 1859, als Garibaldi seine Freischärlertruppen bildete und einen Zug zur Befreiung Ungarns vom Habsburger Absolutismus plante, beschloß Steinacker, sich dieser Expedition anzuschließen und erwarb für diesen Zweck ein Gewehr. 1864 betonte er während eines Besuches seiner Zipser Verwandten, daß er ähnlich patriotisch fühle wie sein revolutionärer Onkel Paul Veszter.
Da er außerdem seit frühester Jugend den Kontakt zu echten und assimilierten Magyaren, auch in Deutschland und im Ausland, bewußt suchte und pflegte, bildete sich bei ihm eine magyarenfreundliche und ungarisch-patriotische Haltung aus, die sich im Grundsätzlichen niemals änderte.
Auf der anderen Seite gab es in seinem Leben genügend Anstöße, sein Deutschtum nicht verkümmern zu lassen: seine Schüler- und Studentenzeit in Deutschland mit einer Reihe von engen persönlichen Bindungen und tiefen Erlebnissen, wie etwa der aktiven Teilnahme an der Schillerfeier 1859 oder die ausgedehnten Wanderfahrten durch die deutschen Länder und die Schweiz. Seine dabei geweckte Begeisterung für landschaftliche Schönheit wie für kulturellen Regionalismus wurden ihm zum Ansporn, das geistige Band der ungarländischen Deutschen mit ihrem Muttervolk nicht abreißen zu lassen. Diese mehr unbewußte Motivation wich unter dem Einfluß seines Schwiegervaters und angesichts des Niedergangs des deutschen Bürgertums in der Hauptstadt der Erkenntnis, daß dieses zum Wohle des gesamten Staates erhalten werden müsse. Es sei nämlich ausschlaggebend beim Umbau des Landes zu einem freiheitlichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und modernen Staat. Doch der antiliberale Regierungskurs nach 1875 und die Preisgabe der bürgerlichen Ideale durch den neuen Mittelstand entzogen einer Innenpolitik seiner Vorstellung buchstäblich den Boden.
Angesichts des immer stärker um sich greifenden, ja häufig vom Staat ausgehenden Magyarisierungsdruckes erweiterte sich er Einsatz für einen bürgerlich-deutschen Stand nach der Jahrhundertwende zum Kampf für den Erhalt einer gesamten Volksgruppe. Die Härte dieser Auseinandersetzung unterwarf die Loyalität als Deutschungarn einer harten Belastungsprobe.
Doch ist jedem Betrachter von Steinackers Leben augenscheinlich, daß seine Entscheidungen in allen Lebenslagen vom Bewußtsein getragen waren, Deutscher aus Ungarn zu sein. Seine liberale Einstellung, eine Konstante des deutschungarischen Bürgertums, behielt er in seinem Einsatz für das deutsche Bürgertum stets bei. Erst die Vorherrschaft einer Oligarchie und die Unterdrückung der nationalen Volksindividualitäten in Ungarn machten ihn zum Minderheitenpolitiker, der die politische und kulturelle Gleichberechtigung zu seinem zentralen Anliegen erhob. In der Phase, da er als Berater des Thronfolgers großösterreichische Politik betrieb, lag ihm ein Umbau des Reiches zu einem modernen und, soweit möglich, bürgerlichen Rechtstaat am Herzen. Ein gleichberechtigtes Zusammenleben verschiedener Nationsindividualitäten, Verständnis für und Einfühlung in das Wesen anderer Nationalitäten, die in Durchmischung leben, schienen Steinacker nur in unmittelbarer Bindung an die Dynastie möglich. Er betrieb sowohl die Erhaltung Großösterreichs als auch das Fortbestehen eines unverfälschten Deutschungarntums als „Herzenssache“. Sogar nach der Ermordung des Thronfolgers, die ihn in tiefe seelische Depression stürzte, fühlte er sich dessen Erbe verpflichtet und arbeitete in seinem Sinne aan Reichsreformplänen mit.
Der einflußreiche Politiker
1875 „wandte sich mein Interesse in erhöhtem Maße der Politik zu” stellt Steinacker in seinen Erinnerungen fest. Vorbereitet wurde der Entschluß zu einer politischen Karriere durch die Bekanntschaft mit dem Sachsenbischof Georg D. Teutsch, dessen Geschichte, die die Selbstbehauptung dieser 700 Jahre alten Volksgruppe nachzeichnet, einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Dieselbe nachhaltige Wirkung hatte das Erlebnis des Sachsentages 1874 in Kronstadt als Demonstration eines selbstbewußten, lebenskräftigen Volkstums. In einem Trinkspruch verglich er die Sachsen mit einer Besatzung, die eine alte, schwer bedrohte Burg verteidigt ungeachtet dessen, daß außerhalb viele gleichgesinnte Kämpfer lagern, mit denen sie sich durch einen Ausfall vereinigen könnten.
Der hier empfohlene Schulterschluß mit dem übrigen Deutschtum und den anderen Volksgruppen des Landes gegenüber dem leidenschaftlichen Willen der magyarischen Minderheit zum Nationalstaat wurde einer der Grundsätze, an denen er Zeit seines Lebens festhielt. Dank günstiger Umstände gelang es Steinacker, bereits 1875 für den siebenbürgisch-sächsischen Wahlbezirk Bistritz, später dann für Heltau (1881-88) das Abgeordnetenmandat zu erringen. In seinen Reichstagsreden waren die fortschreitende Lockerung des politischen wie wirtschaftlichen Bandes zwischen den beiden Reichshälften, die freie Entwicklung aller ungarischen Nationalitäten und die Geltung des Bürgertums in dem immer junkerlicher regierten Staat stets wiederkehrende Themen. Schon bald erhielt er daher den Spitznamen „Bürger Steinacker“.
Ein Intrigenspiel als Folge einer mutigen Rede für nationale Gleichberechtigung und die distanzierte Haltung seiner siebenbürgisch-sächsischen Kollegen veranlassten ihn 1888, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Drei Jahre später führte sein Einsatz für eine Wiederbegründung des 1889 auf ungeklärte Weise abgebrannten Deutschen Theaters in Budapest zu seiner vorzeitigen Pensionierung. Wirtschaftlich in Ungarn ohne Existenzgrundlage und politisch heimatlos geworden, zog sich Steinacker nach Wien und Klosterneuburg zurück.
Von hier aus startete er nach einer Südungarnreise im Jahre 1900 seine zweite politische Karriere. Nachdem im ungarischen Adels- und Gentrystaat kein Platz mehr für ein echtes Bürgertum war, wandte sich Steinacker den donauschwäbischen Bauern in Südungarn zu. Sie, die seit Jahren durch verschiedene Staatsgesetze, vornehmlich ab er durch einge ständig weiter um sich greifende nationale Intoleranz politisch und wirtschaftlich „abgekoppelt“ wurden, waren die geeignete Operationsbasis für eine nationale Sammlungsarbeit. Über Zeitungs- und Vereinsgründungen, Teilnahme an Wahlen, Aufbau eines Genossenschaftswesens und einer Parteiorganisation leistete Steinacker die notwendige politisch-wirtschaftliche Kleinarbeit, die für jede nationale Erweckung die Voraussetzung ist.
Besonders wichtig für die Zukunft des ungarländischen Deutschtums war es, daß Steinacker Verbindungen zu einflussreichen Männern und Verbänden knüpfen konnte. Zunächst gewann er die siebenbürgisch-sächsischen Reichstagsabgeordneten Brandsch und Kopony für seine Idee der „ungarndeutschen Gemeinbürgschaft“ und stellte den Anschluß zur Karpatendeutschen Bewegung Raimund F. Kaindls her. 1907 wurde er in den Belvedere-Kreis, das „Schattenkabinett“ des Thronfolgers Franz Ferdinand, aufgenommen, entwickelte sich zum einflussreichen Ungarnberater des künftigen Kaisers und erhielt zum Beweis seiner besonderen Vertrauensstellung den einzigartigen Auftrag, das Thronbesteigungsmanifest auszuarbeiten. Bei der Ausgestaltung der Reichsreformpläne versuchte er mittels einer günstigen Wahlkreiseinteilung das ungarländische Deutschtum so ins Spiel zu bringen, daß es für die Befriedung der innenpolitischen Verhältnisse in Ungarn unentbehrlich sei.
Weiter gingen die Pläne des Alldeutschen Verbandes. Für den Fall einer Auflösung der Doppelmonarchie sah er in den Deutschen der zis- und tranleithanischen Reichshälfte zuverlässige regionale Hilfskräfte für die Erweiterung „Mitteleuropas“ auf nationalstaatlicher Basis und die Abschirmung des Zugangs nach dem Nahen Osten. Obwohl Mitglied des ADV und dessen Vorsitzenden Heinrich Claß in persönlicher Freundschaft verbunden, ist es äußerst unwahrscheinlich, daß Steinacker solche Pläne unterstützte.
Überblickt man das Leben Steinackers in seiner Gesamtheit, dann fallen die vielen persönlichen Bindungen und Freundschaften auf, die seinen Werdegang begünstigten und bereicherten. Entscheidend für eine Beziehung, eine Einstellung in ein Amt war immer die Persönlichkeit, das Vertrauen, das man erweckte und entsprechend zu rechtfertigen suchte. Diese mit dem alten Feudalsystem und dem Hang zum Persönlichen zusammenhängende Praxis ermöglichte dem Verpflichteten einen weiten Handlungsspielraum und dadurch große Entfaltungsmöglichkeiten und dynamische Entwicklungen.
Die heutige Beschneidung des Handlungsspielraumes durch eine Menge von Paragraphen, Vorschriften und Formalien engt die Kräfte ein, statt sie zu entbinden, läßt Initiative und schöpferische Kraft oft irgendwo im Sumpf des Bürokratismus und Formalismus ersticken.
Eine Gesinnung weiterzupflegen, eine Verpflichtung zu übernehmen bedeuten einer freien Persönlichkeit demgegenüber keine Zwangsjacke, sondern einen Leitfaden zu besserer Lebensbewältigung, einen Silberstreif am Horizont, der einen aus Alltäglichkeit und Gebundenheit zu Größerem und Höherem aufschauen läßt.
Nach 1918 zog er sich nach vergeblichen Versuchen eines politischen Neuanfangs in Ungarn und im Burgenland aus der aktiven Politik zurück. Er spielte allerdings aufgrund seiner Verbindungen und Erfahrungen immer noch eine wichtige Beraterrolle innerhalb der europäischen Minderheitenszene, zumal der Minderheitenschutz als Angelegenheit des Völkerbundes eine starke Aufwertung erfuhr. Am 19. März 1929 endete dieses reiche Leben abrupt durch einen Verehrunfall.