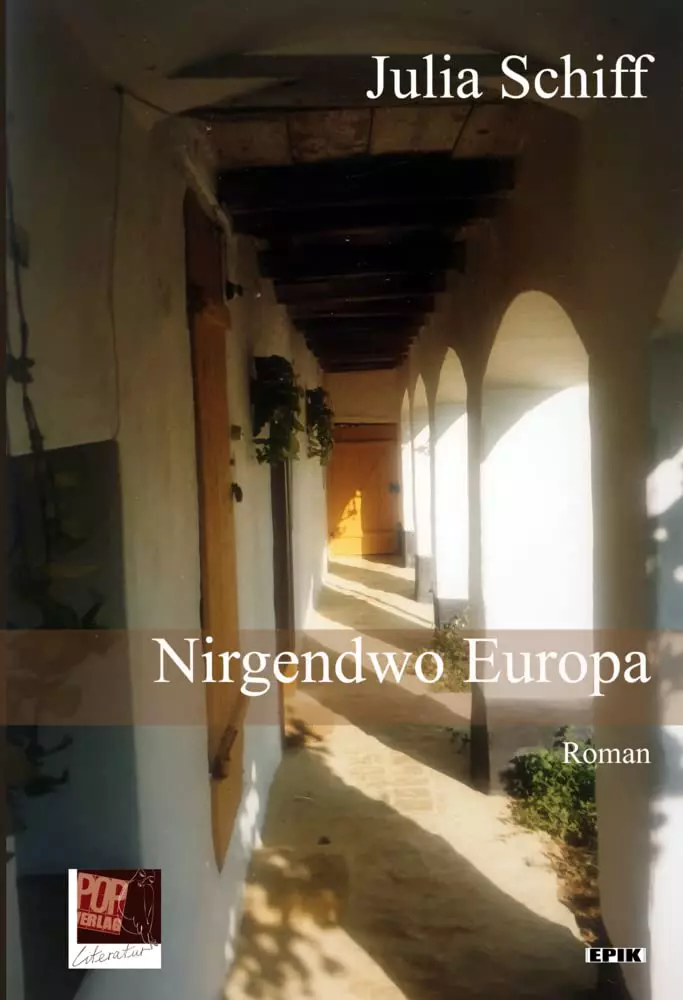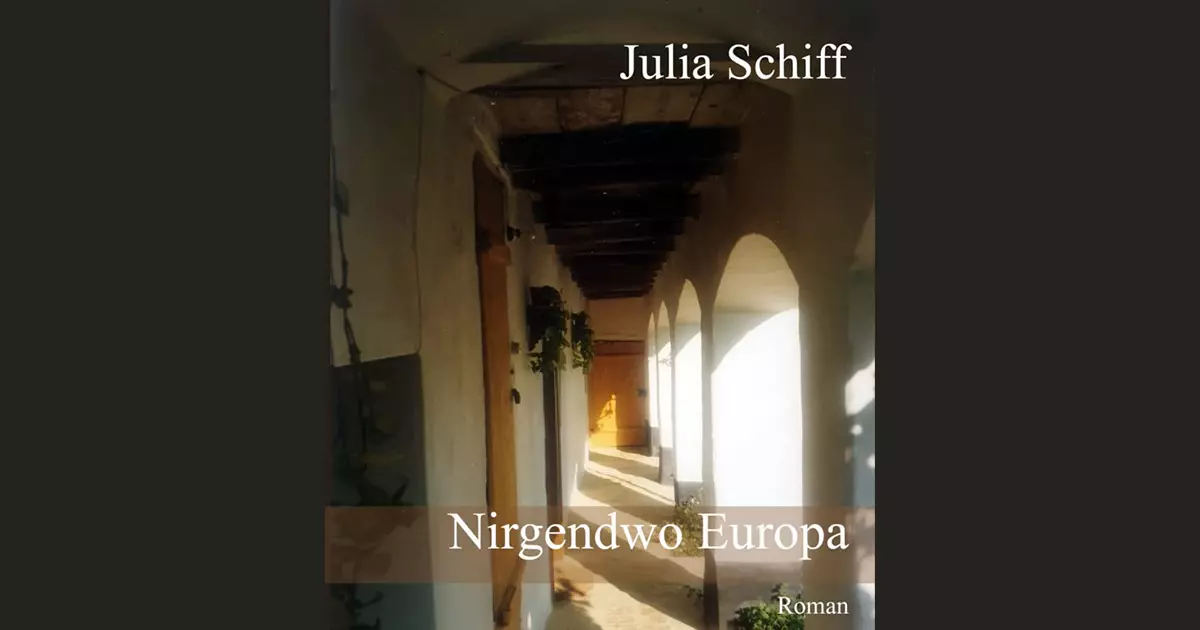Zu den banaterschwäbischen Gemeinden, die auf 300 Jahre seit der Besiedlung zurückblicken können, zählt die heutige Kleinstadt Detta. Über diese wichtige Ortschaft als Zentrum der Gegend wurde jedoch in unseren Publikationen (in den unter Mitwirkung von Geier, Red.) noch nichts veröffentlicht, obwohl es etliche frühe und neuere Buchveröffentlichungen gibt. Herauszuheben ist dazu die Monographie des inzwischen verstorbenen Dettaer und Temeswarer Rechtsanwalts Dr. Anton Büchl (4. Mai 1908, Detta – 19. Januar 1980, München), die derzeit ins Ungarische übersetzt wird. Über die 200-Jahrfeier konnten seinerzeit in der „Temesvarer Zeitung“ 1925 eine ganze Reihe Beiträge gelesen werden.
Aus der Dettaer Erlebnisgeneration gibt es keine bessere Zeitzeugin als die Schriftstellerin und verdienstvolle Übersetzerin Julia Schiff, Tochter des Rechtsanwalts Büchl, die im März ihren 85. Geburtstag begehen konnte. In ihren eigenen literarischen Werken hat Schiff viel festgehalten aus der Geschichte und aus dem Gemeinschaftsleben des Städtchens von früher, eine Autorin, die in drei Kulturen und Sprachen sozialisiert ist – u. a. erhielt sie 2001 den Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg. Bei Wikipedia – für viele Journalisten von heute mit den Texten eine Richtschnur – steht zu Julia Schiff als Schriftstellerin eine Aktualisierung schon lange aus wie auch zu ihrem bereits verstorbenen Ehemann, dem Temeswarer Künstler und Autor Robert Schiff.
Als jüngste Arbeit der Schriftstellerin erschien 2023 im Pop-Verlag Ludwigsburg der Roman „Nirgendwo Europa“ (ISBN 978-3-86356-372-1, 105 Seiten). Verlegt hat die Autorin den Handlungsraum nach Westungarn, in eine Ecke mit einst starken deutschen Gemeinden. Die Zeit des Geschehens ist die ihrer und unserer Generation nahe liegende nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Im einsetzenden Wandel, in der beginnenden Globalisierung und im Werden der EU fühlen sich die Bewohner vieler abgelegener ländlicher Gebiete bis heute als Stiefkinder. Hauptheld ist ein Chemie-Ingenieur – ein 1956er Dissident – der mit seiner indischen Frau aus England in die alte Heimat zurückkehrt.
Einerseits erlebt das Rentnerehepaar die Genügsamkeit in dieser anderen, alten Weltordnung und die Abgeschiedenheit von der Hektik der westlichen Welt, andererseits weiß die erzählende Hauptperson Imre – Sohn eines emigrierten Lehrers aus Großwardein – dass er in dem kleinen ehemals deutschen Dorf als Zugereister Fremder bleiben wird. Das war er auf dem Lande schon immer, wenn er auch nicht als Ausländer galt. Das gekaufte alte schwäbische Siedlerhaus gibt Gelegenheit, Rückblicke aufzuzeigen: wie und was einmal in dem Haus, im Hof, in der Wirtschaft und in dem Ort war. Dort gibt es immer noch viele Siedlerhäuser im alten Kaisergelb, wie auch die Kirche aus dem 18. Jahrhundert mit der alten Linde – so wie es in der deutschen Urheimat war. Akribisch getreu zeichnet die Autorin detailfreudig Bilder der Landschaft, des Dorfes und seiner Bewohner. Das geschieht in einer bilderreichen Sprache, mit vielen zutreffenden Feststellungen: „Wenn die Sprache in der Familie nicht mehr gesprochen wird, stirbt sie aus“ (S.18) oder „Häusern wie Menschen ist ihre Dürftigkeit anzusehen“ (S. 23) wie auch „Ja, damals hing noch der Rang eines Menschen im Dorf von seiner Wirtschaftskraft ab“ (S. 28).
Die beiden Weltkriege mit einschneidenden Folgen, Zwangsumsiedlungen und Menschenopfern in fast allen Familien – daher immer wieder Gesprächsthema – werden nur am Rande erwähnt. Hingegen kommen alle nachfolgenden Ereignisse in die Handlungen: Enteignungen, Zwangskollektivierung, 1956er Revolution, Landflucht der jungen Generation, nicht mehr gepflegte Weingärten, Roma-Familien im Dorf, die sich selbst nur als Zigeuner bezeichnen, und schließlich Arbeiten im Ausland, Dorfschulschließung und Kinder, die dann in öffentliche Verkehrsmittel versetzt werden, Zweitwohnungen für Sommerfrischler aus der Stadt, zwei Frauen in einem Bett, Fremdgehen, der schwierige Mentalitätswandel, die oft übertriebene Political Correctness in Deutschland etc. Aber auch die Feiertage im Dorfleben, von Ostern bis Weihnachten, eine Hochzeit und die Beerdigung der Dorfältesten sind eingeflochten – hier verbunden mit einer interessanten Beschreibung des Generationen-Friedhofs.
In politische Debatten am Schluss platzt die Nachricht, dass nun die alte katholische Dorfkirche einsturzgefährdet sei. Das Ende lässt Zuversicht aufkommen, denn die beratenden Männer beschließen das Schicksal der Kirche in die Hände der jungen, aus dem Dorf stammenden, inzwischen bekannten Schauspielerin und Sängerin Sandra Holczinger zu legen, die seinerzeit die alten schwäbischen Volkslieder gesammelt und im Dialekt auch vorgetragen hatte. Von ihr sagen sie: „Wahre Heimatliebe darf nicht unterschätzt werden“ (S. 105). Und durch den ganzen Roman zieht ein schwäbischer Faden hindurch – der ergibt eine besondere Lektüre.