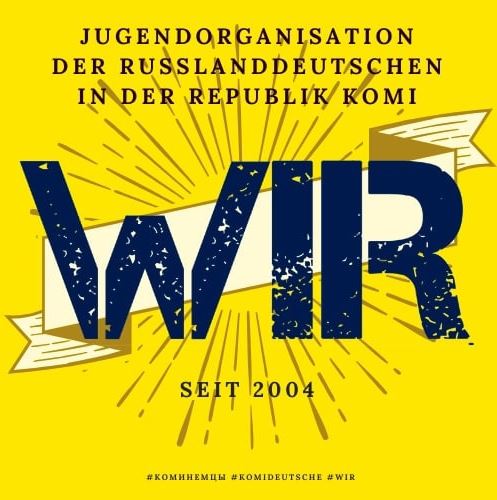Das Sonntagsblatt im Interview mit Sophia Feltsinger, der ehemaligen Vorsitzenden der russlanddeutschen Jugendorganisation WIR
Das Interview führte Armin Stein.
SB: Welche Position haben Sie innerhalb der russlanddeutschen Gemeinschaft gehabt? Beschreiben Sie bitte Ihr Tätigkeitsfeld.
SF: Ich war Vorsitzende von „WIR“, der Jugendorganisation der Russlanddeutschen in der Republik Komi und Teilnehmerin der Tanzgruppe „Tanzkreis”.
Als Vorsitzende habe ich vielfältige Projekte für Jugendliche und junge Frauen und Männer organisiert. Mit meinem Team habe ich Studienreisen durch deutsche Siedlungen in der Republik Komi, Spiele, Wettbewerbe und Workshops, Festivals und Gedenkfeiern, Austausch zwischen unserer Organisation und junger Leute aus Offenburg (Deutschland) veranstaltet. Ich hielt es für wichtig, Jugendliche für unsere Organisation zu gewinnen, damit sie die Möglichkeit haben ihre Identität zu realisieren, ihre Geschichte, Sprache und Kultur kennen zu lernen. In der Organisation gibt es Leute, die keine deutschen Vorfahren haben, jedoch unsere Programme und Veranstaltungen mögen. Sie möchten mehr über Russlanddeutsche lernen und uns beim Bewahren unserer kulturellen Identität helfen.
Als Tänzerin von „Tanzkreis” haben ich mit meinen Mittänzerinnen und Mittänzern deutsche Volkstänze erlernt und Russen mit der deutschen Tanzkultur vertraut gemacht.
SB: Wie würden Sie ihre (deutsche) Identität beschreiben? Wo/Von wem wurde Ihnen diese vermittelt?
SF: Wenn man mich über meine Identität fragt, antworte ich immer, dass ich Russlanddeutsche bin. In diesem Wort drücke ich meine Nationalität – ich bin aus Russland, meine Heimat ist Russland – und mine Ethnoidentität – als Deutsche – aus. Aber die deutsche Kultur in Russland ist nicht gleich der deutschen Kultur in Deutschland. Unsere Volksgruppe hat eine von den Bundesdeutschen verschiedene Geschichte. Ich erhielt meine Identität von meinen Eltern. Mein Vater ist Russlanddeutscher. Leider spricht er kein Deutsch und weiß wenig über die Traditionen. Mein Großvater verstarb, als mein Vater zwei Jahre alt war. Seine Mutter hatte Sorgen wegen der Beziehungen der Russlanddeutschen zu der Sowjetunion. Sie hat ihre Kinder vor deutschen Traditionen und Familiengeschichten abgeschirmt. Meine Mutter ist Russin. Sie hat mir und meiner Schwester über Russlanddeutsche, unsere deutschen Vorfahren erzählt. Sie hat uns deutsche Traditionen gelehrt und mit uns deutsche Feste gefeiert.
SB: Wie ist die Altersstruktur der deutschen Gemeinschaft? Kann die Identität an die jüngere Generation weitergegeben werden?
SF: Unter den Russlanddeutschen in der Republik Komi gibt es meistens Senioren und Kinder, die aktiv im Vereinsleben tätig sind. Für Russland ist dies eine typische Entwickung für alle ethnokulturellen Vereine. Aber unsere autonome Gemeinschaft hat eine Jugendorganisation, eine Schulgruppe, Tanzkreise und Chöre. Nicht alle ethnokulturellen Vereine in der Republik haben Jugendkreise!
In meiner Republik gibt es noch jüngere Leute mit deutschen Vorfahren, die ihre Geschichte und Traditionen kennen lernen möchten. Es ist wichtig, dass die deutsche Autonomie verschiedene Formate für jüngere Interessenten bietet. Wenn man will, lässt es sich hier singen, die deutsche Sprache und Volkslieder erlernen. Wenn man Geschichte mag, kann man in den Archiven recherchieren und Beiträge zu Konferenzen machen. Alle Jugendinitiativen werden unterschützt.
SB: Wie ist der Sprachgebrauch innerhalb der deutschen Gemeinschaft? Ist Deutsch als Muttersprache weit verbreitet?
SF: Leider ist Deutsch als Muttersprache nicht weit verbreitet. Wegen Stalins Politik haben sowjetische Deutsche ihre Kinder vor jeglichem Deutschen ferngehalten. In meiner Republik sprechen nur Senioren den deutschen Dialekt als Muttersprache. Erwachsene, Jugendliche und Kinder lernen Hochdeutsch als Fremdsprache. Aber in der deutschen Gemeinschaft benutzen wir beide Sprachen (Deutsch und Russisch). Bei allen Veranstaltungen gibt es Informationen auf Deutsch und Russisch, deutsche Musik, Lieder, charakteristische Elemente. Projekte und Feste finden entweder mit einem deutschsprachigen Block oder fast ganz auf Deutsch statt. Leider ist die Website über unsere Gemeinschaft nur auf Russisch verfügbar.
SB: Wie ist die Situation der politischen Vertretung der Minderheit? Verfügt die Minderheit über eine Selbstverwaltung?
SF: Wir als Verein, haben keine politische Vertretung. Wir sind nur kulturell und sozial tätig und machen keine Politik. Trotzdem gibt es Russlanddeutsche unter den Abgeordneten, diese sind jedoch nicht Mitglieder bei uns. Unsere Selbstverwaltung ist die „Föderale Nationale Kulturautonomie der Russlanddeutschen“, kulturelles und organisatorisches Zentrum. Über die Jugendorganisation der Russlanddeutschen, „WIR”, sind die Gemeinschaften in ganz Russland miteinander verbunden.
SB: Gibt es eine zufriedenstellende mediale Repräsentation in deutscher Sprache?
SF: Ja, wir haben gute Bücher auf Deutsch, das Institut für Ethnokulturelle Bildung (Moskau) und der Verlag „MaWi Group” (Moskau) sind die wichtigsten Herausgeber. Diese Bücher sind nicht nur für Schule und den „Sprach-Club“, es sind Zeitungen, Zeitschriften, Märchen, geschichtliche und wissenschaftliche Literatur.
In meiner Republik ist unter den Mitgliedern der deutschen Minderheit die „Moskauer Deutsche Zeitung“, eine alte und berühmte russlanddeutsche Zeitung (Anmerkung: nach der Wende neugegründet), sehr beliebt. Alle Information über unsere Gemeinschaft sind auf unserer Webseite nur auf Russisch auffindbar. Leider haben wir keinen festen Journalisten, der des Deutschen mächtig ist. In den sozialen Netzwerken (Instagram, VKontakte) schreiben Jugendliche ihre Nachrichten in beiden Sprachen.
SB: Wie stark war/ist Ihre Gemeinschaft von der Abwanderung von Mitgliedern nach Deutschland betroffen?
SF: Wegen der Abwanderung nach Deutschland in den 1990ern wurde die Organisation „Wiedergeburt” geschlossen. Trotzdem haben sich die verbliebenen Russlanddeutschen als Deutsche Kulturautonomie organisiert. Zurzeit gibt es noch Abwanderung nach Deutschland, aber diese ist nicht so groß wie in den 90ern. Es gibt eine Abwanderung von Jugendlichen und Erwachsenen in andere russische Städte, wo junge Leute ihre Ausbildung machen oder Arbeit suchen. Das schadet der Gemeinschaft. Aber die freien Plätze in der Organisation werden stets durch neue Personen mit neuen Kräften und Ideen ersetzt. Ich finde das sehr gut, weil junge Menschen aktuell Projekte machen können.
SB: Wie ist das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu der Minderheit?
SF: In Republik Komi wohnen circa 130 verschiedene Völker. Es gibt keine ethnischen Konflikte. Natürlich kann man Leute mit Vorurteilen treffen, die die Russlanddeutschen immer noch Faschisten nennen. Aber die Zahl dieser Leute ist sehr gering. In der Republik Komi respektiert man die Deutsche Gemeinschaft, sie hat ein gutes Ansehen als aktive Gruppe, die jedes Jahr mehr als 10 sozio-kulturelle Projekte durchführt und und viele Teilnehmer bei ihren Veranstaltungen hat.
SB: Verfügt die deutsche Minderheit über ein eigenes Bildungssystem? Wie ist die Situation der deutschen Sprache innerhalb des Bildungssystems?
SF: Leider ist Englisch am populärsten. Die Kinder lernen lieber Englisch in den Kindergärten und Schule. Ihre Eltern denken, dass nur Englisch eine Zukunft hat. Man findet nämlich überwiegend Studenten, die Englisch lernen und beherrschen, an den Universitäten. Nur zukünftige Lehrer lernen Englisch und Deutsch oder Französisch. Lehrer, die Deutsch und Französisch lernen, sind selten.
Natürlich interessiert sich die deutsche Gemeinschaft für die Verbesserung des Prestiges der deutschen Sprache. Wir organisieren Sprachclubs auf verschiedenen Niveaus und Intensivkurse, Sonntagsschule für Kinder und wir haben eine deutsche ethnokulturelle Jugendgruppe, in der Schüler mit Kindern und ihre Altersgenossen über die deutsche Sprache und Kultur sprechen, sich gegenseitig motivieren.
Die deutsche Minderheit zusammen mit dem Bildungsministerium der Republik Komi organisiert Gruppen in deutscher Sprache in Kindergärten.
Seit 1992 gibt es eine deutsche Schule in Syktywkar, die zur Bewahrung der deutschen Sprache und Kultur in der Republik erschaffen wurde.
SB: Welche Zukunft sehen sie für die deutsche Minderheit in Ihrer Herkunftsregion? Hat sie eine Zukunft?
SF: Ich glaube, dass sich die Leute immer für ihre Geschichte und Identität interessieren werden. Vielleicht werden auch andere deutsche Vereine erscheinen, neben unserer Gemeinschaft. Corona hat gezeigt, dass Leute einen Ausweg aus jeder Situation finden können. Die Arbeit der Deutschen Kulturautonomie und der Jugendorganisation hat nicht aufgehört, wir organisierten Onlineprojekte und -Treffen, recherchierten und machten Reportagen. Für mich ist die entscheidende Frage: Bleiben deutsche Jugendliche in der Republik Komi? Die Antwort hängt von der Politik der Republik Komi ab. Jugendliche möchten eine sichere Zukunft haben, sie möchten wissen, dass sie morgen Arbeit, Essen und eine Wohnung haben. Im schlimmsten Fall bleiben in der Republik nur deutsche Senioren, für die Komi ihr Zuhause bleibt.
SB: Frau Feltsinger, vielen Dank für das Gespräch!
Bildquelle:https://vk.com/wirrusdeutsch