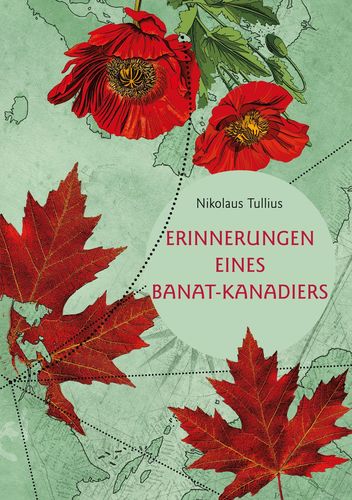Von Dr. Hans Dama
Die Entscheidungen und die Entschlossenheit, seine persönlichen Lebenserfahrungen an die Öffentlichkeit zu tragen, erfordert (den?) Mut des Verfassers.
Nikolaus Tullius, Jahrgang 1935, tat dies wiederholt, diesmal in seinem neuen Buch Erinnerungen eines Banat-Kanadiers, der bereits in seinem in drei Sprachen (deutsch, englisch, rumänisch) erschienenen Buch „Vom Banat nach Kanada“ 2011 (dt. und engl.) bzw. 2013 in Temeswar, rumänisch, seine Lebenserfahrungen veröffentlicht hat.
Dem aus der Banater Gemeinde Alexanderhausen (rumänisch Șandra, ungarisch Sándorháza), zirka 40 km nordwestlich von Temeswar gelegen, stammende Autor hatte bereits das Schicksal in die Lebensspeichen gegriffen: Seine Großeltern Katharina (geb. Beitz) und Johann Lukas „erreichten am Weihnachtsabend des Jahres 1912…“ (S. 16) New York und ließen sich in Cincinatti nieder.
Es war – zu Beginn des 20. Jahrhunderts – die Zeit der Auswanderungen aus dem Banat nach Übersee, die sich nach dem Zerfall der Donaumonarchie und zur Zeit der Weltwirtschaftskrise fortgesetzt hatte. Eigentlich wollten die Banater vorübergehend in Amerika bleiben und mit dem dort verdienten Geld zurück in die Heimat, um dort wirtschaftlich expandieren zu können. Doch es kam oft anders: Manche Familien blieben in der neuen Heimat.
Die ins Banat zurückgekehrten Großeltern des Autors – seine Mutter wurde 1915 in Cincinatti geboren – fanden – die Friedenverhandlungen von Trianon und Versailles hatten Europa völlig verändert – eine andere Heimat vor, die nun zum Königreich Rumänien gehörte. Man musste sich an eine neue Staatsprache und an andere Strukturen gewöhnen. Der Verfasser liefert an den Leser eine detaillierte Beschreibung seines um 1833 auf dem Prädium Pakatz angelegten und durch Binnenwanderungen entstandenen Geburtstortes und dessen Einwohner, die erst zu einer dörflichen Gemeinschaft heranwachsen mussten.
In das sogenannte Contract-Dorf, das zur Herrschaft des Bischofs von Agram, Alexander von Alagowitsch, gehörte, kamen im Zuge der Binnenwanderung Siedler aus den umliegenden Gemeinden (Bogarosch, Grabatz, Tschadat, Billed, usw.). Die TULLIUS kamen aus Tschanad (aus Triebswetter kam nur seine Ururgroßmutter Maria Anna DUPONT).
Der Raum, ein ehemaliges Sumpfgebiert, musste nach den Türkenkriegen des 17. Jahrhunderts von den Zuwanderern urbar gemacht werden, wobei viele Ansiedler durch Cholera-, Typhus- und Malariaepidemien den Tod fanden.
Das 20. Jahrhundert erleichterte die Lage der Dorfbewohner keineswegs: Man hatte aber auch Lichtblicke zu verzeichnen, wie z.B. die Zulassung seitens der Regierung des Königreichs Rumänien von Schulen in der deutschen Muttersprache, war doch bisher der Magyarisierungsdruck Ungarns allgegenwärtig.
Der 1935 geborene Autor konnte sich jedoch aufgrund der internationale Lage kaum einer Eleichterungsperiode erfreuen: Der aus Deutschland ausgehende Nationalsozialismus griff auf viele Teile Europas über und viele Banater Deutsche, die bisher nur Unterdrückungen in Sprache und Existenz ausgeliefert waren, hoffen nun auf Hilfe aus Deutschland – ein Trugschluss, denn der Zweite Weltkrieg brachte Unheil über die Menschheit.
Doch zunächst beschreibt der Autor sein Elternhaus mit all den Gepflogenheiten, die auf eine glückliche Kindheit schließen lassen, denn noch war ein vermeintliches ausgeglichenes Leben in der Dorfgemeinschaft gegeben – doch mit baldiger Ablaufzeit.
Die 1943 von der rumänischen Armee einberufenen Männer wurden am Temeswarer Bahnhof „eindringlich an ihre Pflicht als deutsche Männer erinnert…“ (S. 21) und den deutschen Streitkräften zugeteilt.
Der in englische Kriegsgefangenschaft geratene Vater gelangte einige Jahre nach Kriegsende nach Kanada, während die Mutter trotz ihrer amerikanischen Staatsbürgerschaft zur Zwangsarbeit nach Russland deportiert wurde und von dort nicht mehr zurückkehrte.
Ergreifend die Szenen, in denen der Verfasser den Abschied von der Mutter im Perjamoscher Sammellager beschreibt: „Dort reichten wir uns die Hände durch das Eisengitter. Unwillkürlich kam mir der Gedanke, dass ich meine Mutter zum letzten Mal sah…“(S. 26).
Der 10-jährige, nun mit der Oma allein Gebliebene schlitterte schweren Zeiten entgegen. Als Tagespendler besuchte er die Oberstufe eines Temewarer Gymnasiums und schloss dieses dank seiner Begabung ein Jahr vor der Zeit mit der Abschlussprüfung ab und begann das Studium der Elektrotechnik an der Temeswarer Hochschule „Politechnica“.
Unter misslichen Umständen in den sogenannten Studentenbehausungen jener Zeit erlebte Tullius 1956 den Volksaufstand in Ungarn und die damit verknüpften Studentenunruhen in Temeswar. Die von den in Temeswar stationierten Einheiten der sowjetischen Armee in Richtung Ungarn rollenden Panzer gelangten durch seinen Geburtsort Alexanderhausen, so als befände man sich im Zweiten Weltkrieg…
Ein weiterer Schicksalsschlag suchte den Verfasser im November 1957 heim: Das Ableben seiner Oma, bei der er durch all die elternlosen Jahre einen Halt gefunden hatte. Nun gab es nur eine Lösung für ihn: zum Vater nach Kanada.
Nach Abschluss des Studiums als Diplomingenieur zunächst den Arader Stadtwerken zugeteilt,
wurde der Ausreiseantrag zu seinem Vater nach Kanada im Rayonszentrum Großsanktnikolaus, zu dem auch sein Geburtsort gehörte, gestellt und nach diversen Versuchen, ihn umzustimmen, durfte er schließlich 1961 nach Kanada ausreisen.
Nach der Landung in Montreal sahen sich Vater und Sohn nach 17 Jahren Trennung wieder. Auch Banater Landsleute waren zum Empfang erschienen. Von allen Seiten: Frage über Fragen, zumal ja die Landsleute nach der kommunistischen Machtergreifung nicht mehr in die Heimat reisen konnten und wollten.
Der Banater Neo-Kanadier musste sich in der neuen Welt, der Landessprache und in den neuen Gegebenheiten zurechtfinden; ein schwieriger Weg, den viele Aussiedler beschreiten mussten.
Doch der Verfasser hat es dank seiner Beharrlichkeit, seiner Intelligenz geschafft, rasch Fuß zu fassen. Nach Fortbildungskursen und einem Firmenwechsel gelangte er zu einer Firma, welche in der Technologie aktiv war, die bald als „hightech” bekannt wurde und die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, für immer veränderte.
Erst danach konnte an die in seiner Heimat kaum möglichen Reisen und an Familiengründung gedacht werden. Die berufsbedingte Umsiedlung nach Ottawa veränderte sein Leben: Die Bekanntschaft mit seiner späteren Frau Olivia Donna, die Geburt ihrer Söhne Raimond und Conrad trugen zu abermaligen Änderungen im Leben des Autors bei, der gleichzeitig zum Leiter einer Entwicklungsabteilung in Montreal bestellt wurde, doch die Rochade Montreal-Ottawa und umgekehrt sollte ja im Berufsleben Fortsetzungen finden.
Nach dem Tod seines Vaters 1982 kam es zu Testamentproblemen wegen einer geänderten Letztverfügung, die sich der Autor nicht erklären konnte und der Wesensart der Banater Schwaben fremd war, was auch zum Riss zwischen der kanadischen Familie seines Vaters und der eigenen beigetragen hat.
Umso mehr freute 1985 das Wiedersehen seiner Heimat nach 25 Jahren im Zuge der ersten Reise ins Banat über Frankfurt/Main, Ulm, Attersee (OÖ), Neusiedl am See (Burgenland), Temeswar.
Zurück in einer Welt, die ihm vertraut und doch fremd war: Hotelaufzüge im Temeswarer „Continental“ – man musste die Koffer selber zu den Zimmern schleppen – trugen wohl zu keiner freundlichen Begrüßung bei.
Dann die Enttäuschungen auf dem Friedhof von Alexanderhausen, als man vor Omas Grab verweilte, was jedoch später behoben werden konnte.
Erfreulich waren hingegen die Fachtagungen und -konferenzen, an denen Tullius weltweit und oft auch als Vortragender oder Sitzungsleiter teilzunehmen eingeladen wurde und ihn auf diese Weise, nebst solchen Teilnahmen in Kanada, in die USA, nach Europa, Japan und Australien führte.
Wichtig erschienen im Familienleben die solide Fachausbildung der Söhne: Raimond, geb. 1973, schloss sein Studium an Harvard mit dem „Bachelor of Arts“ mit „magna cum laude“ mit der Abschlussarbeit „Die Errichtung einer bürgerlichen nationalen Identität – magyarische und 1973 Nationenschöpfer in Ungarn 1760-1848“. Dass der Sohn europäischer Einwanderer ein Harvard-Stipendium erhalten hatte, darauf waren die Eltern besonders stolz.
Aber Raimond wollte mit dem Studieren nicht aufhören und machte nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Georgetown University in Washington seinen Doctor Juris. Conrad, der Jüngere, 1976 geboren, studierte an der Fakultät für Informatik in Carleton und schloss 1999 das Studium als „Bachelor of Science“ in den Fächern Informatik und Mathematik ab.
Eine neuerliche Reise ins Banat erfolgte 2008 anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Absolvierung des Studiums am Temeswarer Politechnikum. Neue Eindrücke flossen auf den Besucher ein, die, im Gedächtnis des Heimkehrers mit den bereits bestehenden gepaart, die Entwicklungen in den ihm so vertrauten Örtlichkeiten des Banats teils mit anderen teils mit vertrauten Augen bewerten ließen. Die obligaten Besuche im Geburtsort Alexanderhausen, vor allem auf dem Friedhof, weckten nostalgische Erinnerungen, doch das Elternhaus gab es nicht mehr; an dessen Stelle ein Neubau und Veränderungen im Garten haben das aus Kindheits- und Jugendjahren bestehende Bild völlig verändert: „Um Dorf war alles grün, die Bäume, die Sträucher, das Gras. Die einstigen Gräben, die Kaulen, der sich um das Dorf herum windende Eisenbahndamm, alles erschien eingeebnet. Von den zwei Reihen Maulbeerbäumen auf jeder Seite der Gassen standen nur noch Reste […] Mein Geburtshaus steht nicht mehr […]“ (S. 55)
Was sich in den Gedanken des Heimkehrers wohl abgespielt haben muss, kann sich der geschätzte Leser wohl denken…
Erfreulicher waren die Besuche im Lenau-Museum im Geburtsort des Dichters und in Temeswarer Sehenswürdigkeiten: im Banat-Museum, in der Oper, im Dorfmuseum des Jagdwaldes sowie den vormaligen Studentenbehausungen während seiner Studienzeit. Auf dem Josefstädter Markt boten keine schwäbischen Bäuerinnen mehr ihr Obst und Gemüse an. Dort tummelten sich sonderbare Gestalten herum. Das Bild hatte sich auch hier grundlegend verändert.
Auch nach der Rückkehr in die neue Heimat beschäftigten den ins Banat heimgekehrten Besucher Fragen, auf die keine Antwort zu finden war: „Ist es vorteilhaft in der Gegenwart zu leben und das Banat, so gut es eben geht, zu vergessen? Oder sollte man, so oft es möglich ist, eine Reise dorthin unternehmen? Eine definitive Antwort auf diese Frage habe ich leider noch nicht gefunden. Eine gewisse Befriedigung bringt der Gedanke, dass wenigstens die Ahnen ein ewiges Anrecht auf ein Stückchen Heimat haben, nämlich auf zwei Quadratmeter Erde in unseren einst so schönen Friedhöfen im Banat.“ (S. 62)
Von den zahlreichen, vom Ehepaar Nikolaus und Donna Tullius unternommenen Reisen, geht der Autor besonders auf eine Tahiti-Reise ein, die wohl jeden Besucher in staunende Bewunderung zu versetzen vermag; nicht nur die Insel Bora Bora mit ihren 70 Quadratkilometern, den herrlichen Naturschönheiten, verhelfen ihr zum Prädikat „Schönste Insel der Welt“…
Im letzten in der Standardsprache verfassten Beitrag setzt sich der Verfasser mit dem Thema „Wege im Leben“ (S. 77-80) auseinander und weist nach den Enteignungen und Nationalisierungen der Banater (und nicht nur dieser) Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg darauf hin, dass der einzige Ausweg zu einer sinnvollen Existenz, die gute schulische Ausbildung darstellte. Viele rumäniendeutsche Söhne und Töchter folgten, so die Eltern diese Unterstützung fördern konnten, dem Weg zu einer höheren Schuldbildung, die häufig aber auch von den Auszubildenden durch Werksarbeit und auf dem zweiten Bildungsweg bewältigt wurden – als mögliche Chance, gute Berufswege im Leben einschlagen zu können.
Am eigenen Beispiel versucht der Autor diese Entwicklung zu veranschaulichen (vgl. S. 77). Auf diese Weise hat sich die Generation junger Ingenieure, in deren Reihen sich viele Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen befanden, als eine neue Generation von Intellektuellen herausgebildet, die dem Land und der eigenen Ethnie zu Ansehen und Genugtuung verholfen haben.
Im zweiten Teil des Buches (S. 81 ff.) „Schwowisch Gschriebenes“ bietet der Verfasser Texte in einigen Unterkapiteln (Dorf uf dr Heed/S. 81-115/; Dorflewe /S. 116-158/; Was vorkumm ist /S. 159-178/; Verschiedenes /S. 179-215/) an.
Im so wichtigen Abschlusskapitel des Buches „Wurzeln im Herzen, Flügel im Geist“- Christa Albert, Hans Schuch“ (S. 216-219), erschienen am 20. November 2020 in der Banater Post, gratuliert die HOG Alexanderhausen dem Jubilar zum 85. Geburtstag und würdigt ihn anhand einer konzentrierten Darstellung seines Lebens- und Schaffensweges, indem seine Veröffentlichungen in Bezug auf seinen Heimatort und seine Erinnerungen als wichtige Bestandteile der Banater Leistungs- und Erinnerungskultur hervorgehoben werden.
Seine Einstellungen bezüglich Genese seiner eigenen Familie wie die der Ethnie der Banater Schwaben, diesen den verdienten und erwiesenen Respekt für die historisch erbrachten Leistungen zu zollen und sich selber als Spross aus diesen Reihen zu betrachten, ist für Tullius selbstverständlich. Mit diesem und durch dieses Ethos hat er sich einen bleibenden und respektvollen Ehrenplatz in der Geschichte seiner banaterschwäbischen Volksgruppe verdient.
________________________________________________________
Nikolaus Tullius: Erinnerungen eines Banat-Kanadiers. Einleitung: Hans Gehl. BoD – Books on Demand, Norderstedt 2022, 219 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Preis: 9,90 € (D); . ISBN: 978-3-7557-4613-3